
Ich mag die Schweiz, weil sie multikulturell, demokratisch, liberal und sozial ist. Weil sie es vermag, scheinbare Gegensätze in Einklang zu bringen: Freiheit und Zusammenhalt, Innovation und Tradition. Und weil sie eine einzigartige Natur bewahrt – Berge, Seen, Wälder, Landschaften.
Wir dürfen patriotisch sein – nicht nur am 1. August. Aber ohne Überheblichkeit. Patriotismus darf nie in Nationalismus kippen.
Unsere Heimat ist mehr als ein geografischer Ort. Die Werte, die sie tragen – Demokratie, Freiheit, Solidarität – sind universell. Darum zeigt sich Heimatliebe am besten im Engagement für Menschenrechte – lokal, national, international.
Was wir brauchen, ist ein Patriotismus, der verbindet.
Der nach vorne schaut.
Der uns motiviert, gemeinsam an einer besseren Schweiz zu bauen –
für alle, die hier leben und leben werden,
für gute Nachbarschaft in Europa
und für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.
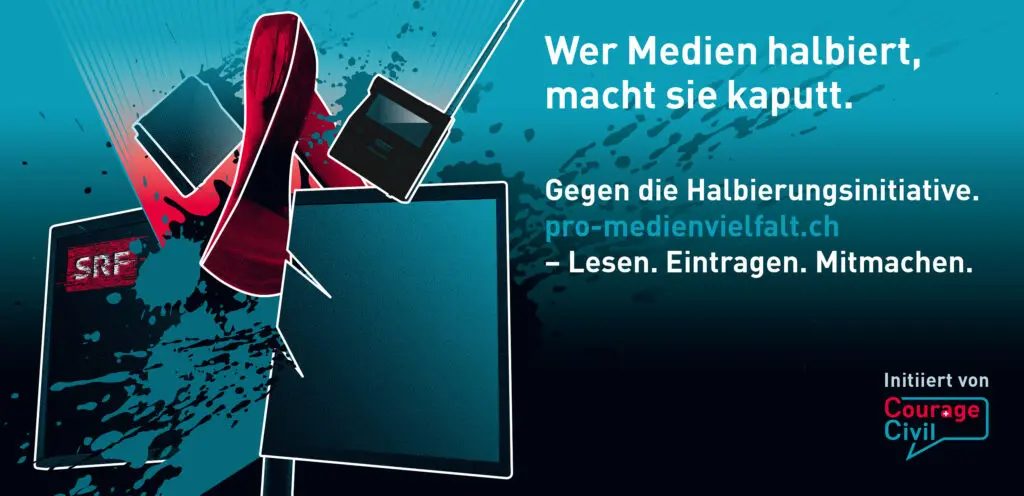
Am kommenden Montag behandelt der Nationalrat die sogenannte Halbierungsinitiative. Sie will die Radio- und Fernsehabgabe auf 200 Franken senken. Das tönt harmlos und gut fürs Portemonnaie. In Wahrheit ist es ein Frontalangriff auf die SRG und die Schweizer Medienvielfalt. Und damit auf das, was unser Land zusammenhält: eine gemeinsame Öffentlichkeit, getragen von unabhängiger, hochwertiger Information, Kultur und Unterhaltung – in vier Sprachen.
Dieser Angriff kommt gezielt. In ganz Europa sind öffentlich-rechtliche Medien à la SRG in Bedrängnis. Die AfD, Orban, Italiens Postfaschisten und Trump-inspirierte Populisten wollen sie schwächen oder zerschlagen. Weil unabhängiger Journalismus ihnen ein Dorn im Auge ist. Auch die 200-Franken-Initiative ist Teil dieser Angriffe. Es geht nicht um Entlastung. Es geht um Macht über Information.
Wer die Initiative verharmlost, spielt mit dem Feuer. Bei einer Annahme würde der SRG die Hälfte des Budgets fehlen. Die Folgen: Rückzug aus den Regionen. Abbau von über 2’400 Stellen. Kahlschlag bei Kultur, Sport, Film, Musik. Und ein massiver Verlust an publizistischer Präsenz, auch in Graubünden.
Die SRG ist nicht perfekt. Aber sie ist einzigartig und notwendig. Niemand sonst berichtet so breit, tief und mehrsprachig über unser Land. Serien wie «Davos 1917», Nachrichten wie «Echo der Zeit», «Telesguard» oder «Il Quotidiano», Live-Wintersport aus St. Moritz oder Arosa – das gäbe es so nicht mehr.
Nicht nur Rechtspopulisten bekämpfen den Service public, auch Teile der Verlegerwelt. Sie suchen den Feind am falschen Ort: Nicht die SRG ist schuld an der Medienkrise. Schuld sind Google, Facebook, TikTok. Sie ziehen Milliarden aus unserem Werbemarkt – und geben nichts an die Schweiz zurück. Gegen sie müssten sich die Verleger verbünden, nicht gegen die SRG.
Denn wer die SRG schwächt, schwächt das ganze Mediensystem. Die Erfahrung zeigt – derzeit besonders drastisch in den USA: Wenn öffentlich-rechtliche Medien zusammenbrechen, sinken Niveau des und Interesse am Journalismus. Dann übernehmen Algorithmen und instrumentalisierte Emotionen. Und Wahrheit wird zur Ware.
Ein gewisser Abbau beim Service public lässt sich leider kaum verhindern. Aufgrund von Bundesratsbeschlüssen spart die SRG bis 2029 fast 270 Millionen Franken – rund 17 Prozent ihres Budgets. Das wird schmerzhaft. Aber es ist weniger verheerend als der Kahlschlag der Volksinitiative.
Langfristig braucht es eine nachhaltige Finanzierung. Deshalb schlage ich vor, den Service public künftig über einen unabhängigen Fonds zu finanzieren – gespeist aus einem kleinen, festen Anteil der Mehrwertsteuer. Das entlastet die Haushalte und sichert stabile Mittel für unabhängigen Journalismus. Auch private Medienhäuser könnten daraus unterstützt werden.
Der Nationalrat stimmt am Montag über die Halbierungsinitiative ab. Er kann ein Zeichen setzen für Medienvielfalt, Demokratie und eine starke SRG. Entschieden wird aber in einer Volksabstimmung, voraussichtlich nächstes Jahr. Dann müssen wir uns fragen, ob uns eine kleine Einsparung mehr wert ist als unsere eigene mediale Stimme als Land. Oder ob wir uns bald vielleicht nur noch aus dem Silicon Valley, von Putins Hackern, dem Parteiapparat in Peking und anderen ausländischen Quellen «informieren» lassen wollen.
Dieser Text ist am 28. Mai 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

«Let’s drink to the hard working people, let’s drink to the salt of the earth», singt Mick Jagger in der legendären Working-Class-Hymne der Rolling Stones. Als agnostischer Mensch habe ich gewisse Hemmungen, Bibelzitate zu bemühen. Und doch finde ich: Jagger und die Stones haben recht.
Die hart arbeitenden Menschen schaffen die Werte unserer Wirtschaft. Sie sorgen für Fortschritt und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Durch sie entstehen Würde und Zusammenhalt unter den Menschen.
Die Bähnlerinnen und Chauffeure, die Kindergärtner und Lehrerinnen, die Verkäuferinnen und Lageristen, die Elektroinstallateure und Polizistinnen, die Pflegerinnen und Bauarbeiter, die Sozialarbeiter und Sanitärinnen, die Köche und Apothekerinnen, die Sekretärinnen und Strassenkehrer – sie alle und viele mehr sorgen tagtäglich dafür, dass unser Leben funktioniert. Mit ihrer Erwerbsarbeit einerseits, mit unbezahlter Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit andererseits. Sie sind tatsächlich das Salz der Erde – und das Fundament jeder Gesellschaft.
Denn wir wissen es eigentlich alle: Wenn für eine Woche alle CEOs, Verwaltungsrätinnen oder auch Regierungsrätinnen und Parlamentarier, Bundesrätinnen und Stadtpräsidenten ausfallen, passiert – nichts. Aber wenn für eine Woche alle Pflegerinnen oder Bähnler ausfallen – dann steht das Land still oder sogar am Abgrund.
Deshalb feiern wir die hart arbeitenden Menschen und ihre Arbeit jedes Jahr am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Und an den übrigen 364 Tagen im Jahr setzen wir uns dafür ein, dass Arbeit endlich den Respekt bekommt, den sie verdient – mit Solidarität im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik.
Ein Wort zur Politik: Bitte tut alles, damit Simon Stocker auch den dritten Wahlgang am 29. Juni gewinnt und wieder in den Ständerat gewählt wird. Wir brauchen Simon in Bern, die soziale Schweiz braucht Simon im Stöckli!
Wie ihr wisst, ist der 1. Mai der einzige wirklich globale Feiertag. Denn der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter um Würde, Freiheit und Gerechtigkeit ist ein weltweiter – und zugleich ein Kampf für die Demokratie. Denn Demokratie ist weit mehr als ein politisches Verfahren. Sie ist die Idee einer Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleich sind. In der niemand wegen seines Berufs, Einkommens, Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, Herkunft, Religion oder Denkens weniger Rechte hat als andere. In der niemand über andere herrscht und niemand sich unterwerfen muss. In der kein König, kein Autokrat, keine Oligarchen und keine Milliardäre über das Leben der Menschen bestimmen.
Genau deshalb fürchten die Trumps, Putins, Xis, Erdogans, Orbans – aber auch die Musks, Bezos und Zuckerbergs – die Gewerkschaften und andere Demokratiebewegungen. Denn gemeinsamer Einsatz für gerechte Arbeitsbedingungen und für gleiche Rechte für alle – also gelebte Solidarität – entzieht ihrer Herrschaft und Hetze die Grundlage. Die Werte des 1. Mai sind das stärkste Schutzschild gegen Autokratie und Oligarchie und deshalb heute besonders wichtig.
Denn leider ist der Ernstfall eingetreten: Eine aggressive Grossmachtpolitik ist zurück. Und die Grossmächte dieser Welt arbeiten aktiv gegen Demokratie, Völkerrecht und Menschenrechte – nach innen genauso wie nach aussen.
China ist ein totalitärer Staat, der alles, jede und jeden überwacht und jeden Widerspruch brutal unterdrückt. Russland ist eine faschistische Gangsterdiktatur, die die demokratische Ukraine vernichten und die europäische Einigung zerschlagen will. Und unter Trump liegt nun auch die älteste Demokratie der Welt auf der Intensivstation. Seine permanente Lügenpropaganda, die tägliche Hetze, die Säuberungen in der Bundesverwaltung, die illegalen Massendeportationen, die Missachtung von Justiz und Gewaltenteilung, der rassistische und antifeministische Backlash, die Angriffe auf die freien Medien, die Wissenschaft, Andersdenkende und Minderheiten – sie zeigen die pure Zerstörungswut von Trump und seiner MAGA-Gefolgschaft.
Auch sein absurder Zollkrieg dient weniger wirtschaftlicher Logik als politischem Kalkül. Es wird zum Glück kaum erfolgreich sein, aber Trumps Ziel ist klar: Er will Handelspartner und amerikanische Wirtschaftsakteure gängeln und unterwerfen. Nur wer ihm Loyalität verspricht, darf auf Milde hoffen – das nennt er dann zynisch einen «Deal». Wer sich nicht beugen will, soll hingegen bluten. Diese Methode der wirtschaftlichen Erpressung ist altbekannt – die Mafia nennt das «Schutzgeld», Diktatoren wie Mussolini nannten es «Dirigismus».
Aber auch aussenpolitisch kennt Trump sprichwörtlich keine Grenzen. Genauso wie Xi Taiwan annektieren will, wie Putin die freie Ukraine bombardiert und sie als unabhängiger und demokratischer Staat beseitigen will, beansprucht Trump Panama, Grönland und Kanada für sich. Gaza will er ethnisch säubern lassen und dann eine amerikanische Riviera errichten. Und genau wie Putin will er die EU auseinanderdividieren.
Am schlimmsten aber ist eine Entscheidung Trumps, über die kaum gesprochen wird: die Abschaffung von USAID, der US-Entwicklungsagentur. Das wird Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen das Leben kosten. USAID stellte über 30% der weltweiten humanitären Hilfe bereit. Die Einstellung des Malariaprogramms allein wird laut Schätzungen bis zu 160’000 Menschen, vor allem Kinder, das Leben kosten. Ähnlich dramatisch sind die Folgen für HIV-Behandlungen oder Masernimpfungen. Das ist nicht nur menschenverachtend – das ist kriminell.
Und was macht die Schweizer Politik? Die SVP und FDP empören sich, wenn wir Trumps Politik als das bezeichnen, was sie ist: autoritär, imperialistisch, neofaschistisch. Zugleich biedert sich der Bundesrat in Washington an – und wird von Teilen der Medien auch noch dafür gefeiert. Die FDP fordert angesichts des Zollkriegs ein neoliberales Sparprogramm, die SVP übernimmt Trumps unmenschliche Migrationspolitik, seine Klimaleugnung, seine Verachtung für das Völkerrecht und seine Hetze gegen Europa.
Dagegen müssen wir Widerstand leisten. Auch hier in Schaffhausen und hier in der Schweiz. Gegen den kulturellen Backlash des Trumpismus. Gegen die prinzipienlose Politik des Bundesrats. Gegen den Sozialabbau. Gegen die Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit. Gegen die Hetze gegen Migrant:innen.
Dabei wissen wir, was der wirkungsvollste Widerstand ist: solidarisches Engagement. Für eine soziale Schweiz, mit fairen Löhnen, guten Arbeitsbedingungen und gerechten Renten. Für einen starken Service public. Für bezahlbare Mieten und Krankenkassenprämien. Für echte Gleichstellung, eine gerechte Klimapolitik, eine zeitgemässe Familienpolitik. Für den Zusammenhalt in Europa und eine verlässliche Beziehung der Schweiz zur EU. Für eine Schweiz, die sich mit anderen Demokratien gegen den Imperialismus und für das Völkerrecht einsetzt. Für eine Schweiz, die die Werte des 1. Mai lebt und stark macht – jeden Tag.
Doch woher nehmen wir die Kraft für diesen Widerstand und die Hoffnung für dieses Engagement? Wie verzweifeln wir nicht angesichts der Weltlage?
Immer wenn ich selbst zweifle, denke ich an Yina.
Vor einem Jahr reiste ich mit Swissaid und Kolleg:innen aus dem Nationalrat nach Kolumbien. Obwohl das Land als «Post-Conflict» und «Middle-Income Country» gilt, sind Armut und Gewalt allgegenwärtig. Doch eine starke Zivilgesellschaft leistet Widerstand – für Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Wir lernten Yina Ortega Benitez kennen, heute 27 Jahre alt. Sie ist eine indigene Aktivistin. Als Jugendliche musste sie ihr Dorf verlassen, weil ihr Zwangsprostitution oder Zwangsrekrutierung in eine bewaffnete Gruppe drohten. Dank Swissaid konnte sie studieren, hat heute eine gute Arbeit – und engagiert sich politisch und mit Jugendarbeit für den Frieden. In der Schweiz wäre sie wohl bei der JUSO. Aber während sich hiesige Jusos recht sicher politisch betätigen können, muss sich Yina immer wieder verstecken – ihr Leben ist tagtäglich bedroht. Die bewaffneten Gruppen wollen verhindern, dass sie weiteren Jugendlichen hilft, der Gewalt zu entkommen.
Doch Aufgeben ist für Yina keine Option. Nie. Mit Freund:innen kämpft sie weiter für Frieden und soziale Rechte. Ihre Organisation schreibt einen wundervollen Satz, den ich nie vergessen werde und der perfekt zum 1. Mai passt:
«Frieden ist nicht die Abwesenheit von bewaffnetem Konflikt – Frieden herrscht erst, wenn die Menschen ein Recht auf Bildung, auf gute Arbeit, auf Sicherheit und auf Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit haben.»
Unsere Gedanken sind heute bei allen Yinas dieser Welt.
Freiheit, Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenrechte – das sind die Werte des 1. Mai, weltweit. Sie sind unsere Hoffnung für eine bessere Zukunft. Aber sie kommen nicht von allein. Wir müssen sie erkämpfen. Am 1. Mai – und an jedem anderen Tag.
Es lebe der 1. Mai – hoch die internationale Solidarität!
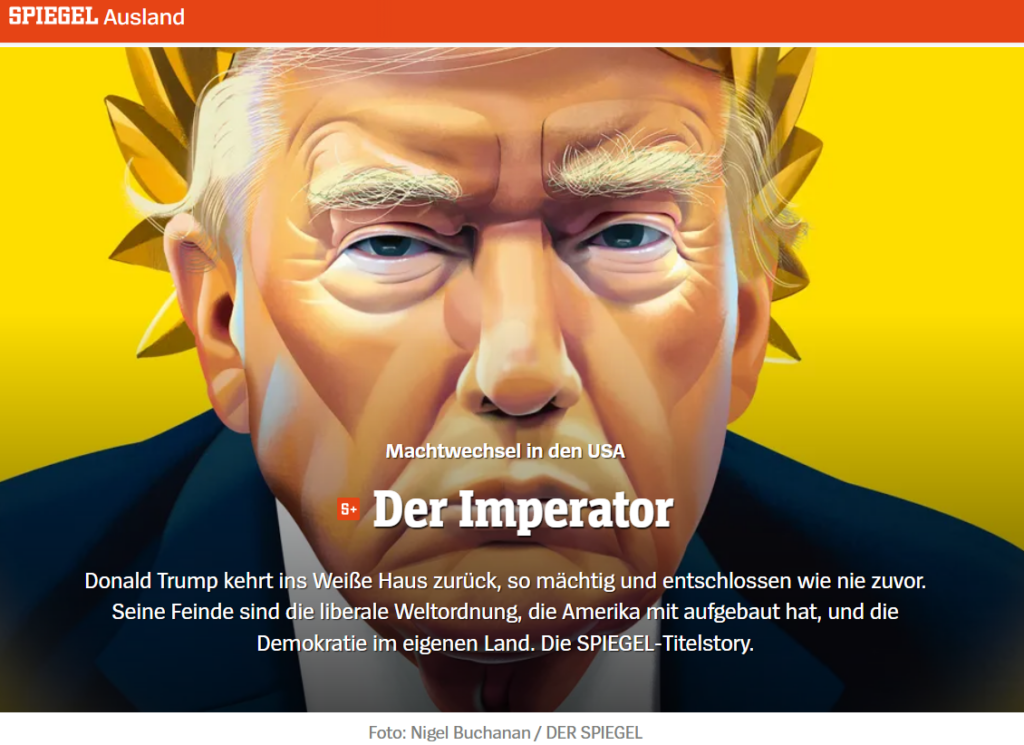
Donald Trump hat letzte Woche der Welt – und damit auch der Schweiz – den Wirtschaftskrieg erklärt. Dabei geht es ihm nicht primär um das Wohl der amerikanischen Wirtschaft, zumal diese unter den inflationstreibenden Zöllen schwer leiden wird. Der Börsenabsturz lässt grüssen. Es geht dem Herrscher im Weissen Haus um autoritäre Machtausübung. Mit seinen willkürlichen Zöllen versucht er, die Handelspartner und die amerikanischen Wirtschaftsakteure zu unterwerfen. Nur wer massive Konzessionen macht und ihm bedingungslose Loyalität garantiert, darf auf etwas Milde hoffen. Das nennt er dann «Deal». Wer sich nicht beugt, soll hingegen bluten. Trumps handelspolitischer Amoklauf zielt darauf ab, Gehorsam zu belohnen und Widerstand zu bestrafen.
Diese Methode der wirtschaftspolitischen Erpressung ist nicht neu. Die Mafia wendet sie mit den Schutzgeldern seit jeher an. Und auch Diktatoren haben Zölle immer wieder als Machtinstrument missbraucht. Zum Beispiel erzwang Benito Mussolini damit die Loyalität der italienischen Industriellen. Zuerst erhöhte er die Zölle für alle, um dann denjenigen Entlastung zu gewähren, die das faschistische Regime stützten.
Nach dem Leugnen der Wahlniederlage von 2020, den Begnadigungen der Putschisten vom 6. Januar, den ständigen Angriffen auf den Rechtsstaat und den willkürlichen Säuberungen in der Staatsverwaltung zeigt nun auch die Handelspolitik, wes Geistes Kind der amerikanische Präsident ist. Wer Donald Trump weiterhin nur als exzentrischen «Dealmaker» sieht, statt seine aggressiven Absichten zu durchschauen, geht ihm auf den Leim und missachtet damit die Interessen und Werte der Schweiz.
Die von der SVP und der FDP verfolgte Strategie der Anbiederung an Trump ist krachend gescheitert. Dass die Bundespräsidentin als einzige europäische Spitzenpolitikerin die Anti-Europa-Hetzrede von Vizepräsident JD Vance in München als «liberal» und «schweizerisch» lobte, bleibt als Peinlichkeit in Erinnerung. Genauso wie die grotesken Aussagen von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, die Trump als Segen für die Wirtschaft und grossen Freund der Schweiz bezeichnete.
Es ist höchste Zeit für einen Strategiewechsel, denn die Lage ist sehr ernst. Das Zeitalter der Grossmachtpolitik ist leider zurück. Damit sich die Schweiz als demokratischer Kleinstaat behaupten kann, braucht es eine prinzipienfeste politische Führung. Genauso wie man sich der Mafia nicht beugt, dürfen wir uns auch nicht vor Trump in den Staub werfen. Wir brauchen keine Anbiederung, wir brauchen Verbündete.
Wenn imperiale Mächte wie Russland, China und die USA die Welt durch Krieg, aggressive Aussenpolitik oder wirtschaftliche Erpressung in Einflusszonen aufteilen wollen, kann die Schweiz nicht länger «zwischen den Blöcken navigieren», wie es die Bundespräsidentin ausdrückte. Unsere Sicherheit und unser Wohlstand können nur im europäischen Verbund gesichert werden. Nur zusammen mit der Europäischen Union und anderen demokratischen Staaten wie dem Vereinigten Königreich und Kanada können wir unsere Souveränität in dieser gefährlichen Welt behaupten. Der erste Schritt dazu ist ein rasches Ja zum Vertragspaket mit der Europäischen Union.
Dieser Text ist am 9. April 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Dem Bundesrat gebührt Lob für seine klare Haltung und seinen Mut in der Europapolitik. Im Dezember hat er erfolgreich die Verhandlungen mit Brüssel abgeschlossen, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu stabilisieren. Letzten Freitag hat er dann auch die von den Sozialpartnern ausgehandelten Massnahmen zur Sicherung des Lohnschutzes vorgestellt. Zeitgleich stellte er klar, dass die SVP-Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit einen direkten Angriff auf die bilateralen Verträge darstellt und die Schweiz in Europa isolieren würden.
Die Auseinandersetzung im Parlament und dann im Abstimmungskampf werden trotzdem herausfordernd. Die eingefleischten EU-Gegner werden ihre isolationistische Propagandawalze ausfahren. Sie werden die EU als bedrohliche Macht darstellen. Obwohl dieses Zerrbild unserer friedlichen Nachbarstaaten angesichts der realen Bedrohungen aus Putins Russland und Trumps Amerika absurd ist. Umso wichtiger ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und der interessierten Öffentlichkeit fünf grundsätzliche Punkte in Erinnerung zu rufen.
- Partnerschaft: Die EU ist nicht unsere Gegnerin, sondern unsere Nachbarin und unser eigentlicher Heimmarkt. Gerade in einer geopolitisch zerrütteten Welt ist ein sicherer Zugang zum Heimmarkt überlebenswichtig für unsere Wirtschaft. Die neuen Verträge bedeuten keine «Unterwerfung», wie die Gegner behaupten, sondern eine Fortsetzung der bilateralen Partnerschaft. Der Bilateralismus ist keineswegs der Liebling der EU, sondern derjenige der Schweiz. Wir haben der EU diese Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgezwungen, weil sie der Schweiz bestmögliche Bedingungen erlaubt: Partnerschaft auf Augenhöhe, sicherer Marktzugang, grösstmögliche Selbstbestimmung. Schweizerischer geht es nicht!
- Rechtssicherheit: Bei den «institutionellen Fragen» im Vertragswerk geht es um Rechtssicherheit. Diese gehört in jeder internationalen Vereinbarung zur Grundausstattung. Im Verhältnis Schweiz-EU hat sie bisher gefehlt, jetzt kommt sie mit einer ausgeklügelten Streitbeilegung endlich. Und wie in jedem bilateralen oder multilateralen Vertrag wird als letzte Instanz kein «fremder Richter», sondern ein paritätisch besetztes Schiedsgericht entscheiden. Streit wird also rechtlich und nicht mehr politisch beigelegt. Das ist ein Gewinn, weil ein verrechtlichtes Verhältnis immer im Interesse der kleineren Partnerin ist, also der Schweiz.
- Souveränität: Die bestehenden bilateralen Verträge sind «statisch». Sie halten einen Zustand beim Abschluss fest und können nur durch mühselige Verhandlungen von Fall zu Fall angepasst werden. Neu werden die Verträge «dynamisiert». Das heisst, dass ihre Aktualisierung endlich zum Normalfall wird. Das ist weit besser als die schleichende Entwertung durch Stillstand, welche wir heute haben. «Dynamisch» heisst aber nicht «automatisch». Dynamisch bedeutet: Wir können zu jeder von der EU beschlossenen Neuerung – souverän – Ja oder Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, kann die EU als Vertragspartnerin mit verhältnismässigen Ausgleichsmassnahmen Kompensation verlangen. Ob eine allfällige Ausgleichsmassnahme wirklich verhältnismässig ist, kann die Schweiz vom paritätischen Schiedsgericht überprüfen lassen.
- Wohlstand: Wichtige Branchen wie das Gesundheitswesen, die Industrie, das Baugewerbe oder die Gastronomie würden ohne die Arbeitskräfte aus der EU kollabieren. Die europäischen Einwanderinnen und Einwanderer zahlen Steuern und zahlen mehr in die Schweizer Sozialwerke ein, als sie von ihnen beziehen. Die Personenfreizügigkeit ist unter dem Strich eine Garantin für das Funktionieren und den Wohlstand der Schweiz. Dies gilt in noch höheren Mass für Graubünden. Zudem ist sie keine Einbahnstrasse: In der EU leben so viele Schweizerinnen und Schweizer wie in der ganzen Ostschweiz.
- Patriotismus: Patriotismus ist nicht dasselbe wie Nationalismus. Patriotismus bedeutet, das eigene Land zu lieben. Nationalismus bedeutet, auf andere Länder hinunterzublicken, sie gar zu verachten. Wer patriotisch handeln will, setzt sich dafür ein, dass die Schweiz ein geregeltes Verhältnis zu ihren Nachbarn hat. Denn nur gute Nachbarschaft und geregelte Beziehungen ermöglichen es unserem Land, seine Zukunft und die unseres Kontinents zu gestalten. Die grossen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich ohnehin nur im Verbund europäischer Staaten und Gesellschaften lösen. Isolation und nationalistische Überheblichkeit schaden hingegen unserem Land und seiner Handlungsfähigkeit und sind darum unpatriotisch.
Es ist völlig legitim und notwendig, um die bestmöglichen innenpolitischen Begleitmassnahmen in Bereichen wie Lohnschutz, Service public oder Zuwanderung zu ringen. Gute Lösungen in den Details des Gesamtpakets sichern am Ende dessen Mehrheitsfähigkeit. Gleichzeitig darf das übergeordnete Ziel nicht aus den Augen verloren werden: Eine geregelte Beziehung der Schweiz mit der EU. Sie ist die Grundlage für die Gestaltung unserer Zukunft und der Zukunft unseres Kontinents.
Spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind stabile Beziehungen zu Europa auch eine geostrategische Notwendigkeit für die Schweiz. Trumps Verrat an der Ukraine und damit auch an Europas Sicherheit, sein Appeasement gegenüber dem Aggressor Putin und seine eigenen imperialen Ambitionen sind auch für unser Land ein Weckruf. Mehr europäische Integration ist auch aus sicherheitspolitischen Gründen das Gebot der Stunde. In dieser gefährlichen Welt ist unsere Selbstbehauptung als Kleinstaat und damit unsere Souveränität nur im europäischen Verbund möglich.
Dieser Text ist als Gastkommentar im Bündner Tagblatt vom 27. März 2025 erschienen.

Trotz eines positiven Jahresabschlusses und einem Rückgang der ohnehin äusserst bescheidenen Bundesschulden beharrt der Bundesrat darauf, staatliche Leistungen weiter zu kürzen, was er euphemistisch «sparen» oder «entlasten» nennt. Die Begründung lautet, die Schweiz habe ein «Ausgabenproblem», weshalb die Schuldenbremse strikt durchgesetzt werden müsse. Dieses Argument ist schlicht falsch.
Der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Verkehr sagte kurz vor seiner Pensionierung, die Schuldenbremse sei in Bundesbern zum «Fetisch» geworden. Er hat recht. Die zu enge und dogmatische Auslegung der Schuldenbremse hat die Schweiz in ein finanzielles Korsett gezwängt, das die Handlungsfähigkeit des Staates einschränkt und mittelfristig den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt unseres Landes gefährdet.
Dabei sind die Schweizer Staatsfinanzen kerngesund. Seit Jahrzehnten liegt die Ausgabenquote des Bundes stabil bei etwa 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Wie kann von einem «Ausgabenproblem» die Rede sein, wenn sich die Bundesausgaben seit über 25 Jahren genau parallel zur Wirtschaftsleistung entwickeln? Die Schuldenquote des Bundes ist eine der niedrigsten weltweit und liegt bei nur 17,8 Prozent des BIP. Wer hier vor Überschuldung warnt, kennt entweder die tatsächlichen Zahlen nicht oder will der Bevölkerung Angst machen.
Obwohl die Staatsquote seit 25 Jahre stabil ist und die Schuldenquote sinkt, gibt es gute Gründe, warum sich dies ändern sollte. Putins Krieg hat den Ruf nach einer grösseren Armee verstärkt und gleichzeitig die Inflation angeheizt, was die Kaufkraft vieler Menschen geschwächt hat. Zu Recht hat die Bevölkerung eine 13. AHV-Rente beschlossen und erwartet Entlastung bei den Krankenkassenprämien. Zudem werden fundamentale öffentliche Güter wie Bildung und Gesundheit im Verhältnis zu Konsumgütern teurer, weil sie sich mit technischem Fortschritt nicht verbilligen lassen. Und nicht zuletzt erfordert die Klimakrise gewaltige Investitionen in die Energiewende und den Bevölkerungsschutz.
Der Bundesrat reagiert auf diese Herausforderungen aber mit massiven Kürzungen öffentlicher Leistungen. Das erste Opfer war die internationale Zusammenarbeit, insbesondere die Entwicklungs- und Friedenspolitik. Dieser Abbau inmitten einer gefährlicher werdenden Welt ist sicherheits- und aussenpolitisch verantwortungslos. Auch bei Bildung, Forschung, Klimaschutz, Biodiversität, öffentlichem Verkehr, Gleichstellung und vielen anderen Bereichen soll gekürzt werden. Diese Abbaupolitik gefährdet die Innovationsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt der Schweiz.
Dabei könnte eine flexiblere Handhabung der Schuldenbremse viele Probleme lösen. Ein Beispiel wäre die Integration der «goldenen Regel» der Staatsfinanzierung, die es erlaubt, Investitionen, die einen volkswirtschaftlichen Ertrag abwerfen, mindestens zu Teilen mit Neuverschuldung zu finanzieren. Denn zum Beispiel Infrastruktur, Forschung oder grüne Technologien erfordern jetzt Investitionen, die uns später auch finanziell zugutekommen.
Die Schweiz hat weder ein Ausgaben- noch ein Schuldenproblem. Wir werden jedoch ein Zukunftsproblem bekommen, wenn wir an einer zu starren Schuldenbremse festhalten und uns der nötigen Flexibilität verweigern. Ein Kurswechsel in der Finanzpolitik ist dringend nötig.
Dieser Text ist am 19. Februar 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Rechtskommission,
vielen Dank für die Möglichkeit, meine Parlamentarische Initiative zu präsentieren. Ihr Inhalt ist einfach und klar: Allen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, die in der Ukraine gegen die völkerrechtswidrige russische Aggression kämpfen, soll eine Amnestie gewährt werden. Diese Amnestie betrifft ausschliesslich Verstösse gegen Artikel 94 des Militärstrafgesetzes, der den Eintritt in fremden Militärdienst unter Strafe stellt. Für etwaige andere Straftaten, die im Rahmen des Krieges in der Ukraine begangen würden, gilt die Amnestie selbstverständlich nicht.
Zum Formellen
Die Kompetenz zur Gewährung von Amnestien liegt bei der Bundesversammlung. Diese Zuständigkeit ist eindeutig in Artikel 173 Absatz 1 lit. k der Bundesverfassung sowie in Artikel 232e des Militärstrafgesetzes verankert.
Laut dem St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung bedeutet Amnestie: «(…) den Verzicht des Staates auf Strafverfolgung oder Strafvollzug gegenüber einer bestimmten oder unbestimmten Vielzahl von Delinquenten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. (…) Anders als etwa das französische Recht hat sie (die Amnestie) jedoch nicht die Aufhebung oder Löschung begangener Delikte zur Folge. Die Amnestie ist der Sache nach ein ‘kollektives Verzeihen’ im Interesse des Staates.»
Es geht also nicht um die Aufhebung von Urteilen, sondern um den Verzicht auf Strafverfolgung und Strafvollzug. Es geht darum, den Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfern «kollektiv zu verzeihen.»
Zum öffentlichen Interesse
Die zentrale Frage ist nun: Liegt dieses kollektive Verzeihen im öffentlichen Interesse der Schweiz? Ich meine klar ja.
Schweizerinnen und Schweizer, die in der Ukraine, beispielsweise in der Internationalen Legion der Territorialverteidigung, gegen die russische Aggression kämpfen, verteidigen natürlich in erster Linie das Territorium und die Bevölkerung der Ukraine.
Auf einer übergeordneten Ebene verteidigen sie jedoch auch zentrale Werte und Grundsätze des Völkerrechts sowie des Schweizer Staates: Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität.
Die Grundsätze der Souveränität und der territorialen Integrität sind völkerrechtlich in der UNO-Charta und in der Schlussakte von Helsinki verankert, welche als eine Art Gründungsurkunde der OSZE gilt. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz soeben zwei Jahre im Sicherheitsrat der UNO vertreten war und ab nächstem Jahr die OSZE präsidieren wird, sind die Grundsätze von UNO und OSZE von grosser aussenpolitischer Bedeutung für die Schweiz und entsprechen damit einem hohen öffentlichen Interesse unseres Landes.
Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit ihrerseits sind Staatsziele der Schweiz, die im Zweckartikel 2 Absatz 1 der Bundesverfassung mindestens sinngemäss festgeschrieben sind.
Wenn wir die UNO-Charta, die Schlussakte von Helsinki und die Bundesverfassung konsultieren und gleichzeitig bedenken, dass die Ukraine einen legitimen Verteidigungskampf führt – während Russland eine illegale Aggression verübt! – stellen wir fest, dass der Kampf einzelner Schweizerinnen und Schweizer in der Verteidigung der Ukraine mit den Werten der Schweiz vereinbar ist.
Daher besteht aus meiner Sicht ein öffentliches Interesse daran, diese Schweizerinnen und Schweizer nicht dafür zu bestrafen. Obwohl es formell offenkundig ist, dass sie das Gesetz brechen.
Zur Neutralität
Die Neutralität ist kein Staatsziel der Schweiz. Der Verfassungsgeber hat bewusst auf eine Verankerung der Neutralität im Zweckartikel 2 oder in den aussenpolitischen Grundsätzen in Artikel 54 verzichtet.
Die Grundlage des Neutralitätsrechts ist also nicht die Bundesverfassung, sondern das Haager Abkommen von 1907. Die dort verankerten Pflichten der «neutralen Macht» gelten für den Staat, nicht für die individuelle Entscheidung einer Bürgerin oder eines Bürgers. Das Neutralitätsrecht verpflichtet den Staat auch nicht, seine eigenen Bürgerinnen und Bürger zu bestrafen, wenn diese in fremden Militärdienst eintreten.
Dies wird durch das Recht und die Praxis anderer neutraler Staaten belegt: So kennen etwa Österreich und Irland kein generelles Verbot für den Eintritt in fremden Militärdienst, obwohl sie genau wie die Schweiz neutrale Staaten sind. Auch Schweden und Finnland – die bis vor kurzem selbst als neutral galten – bestrafen seit jeher fremden Militärdienst nicht.
Artikel 6 des Haager Abkommens besagt sogar explizit: «Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, dass Einzelpersonen die Grenze überschreiten, um in den Dienst eines Kriegsführenden zu treten.»
Die Frage, ob die Schweiz einzelne Bürgerinnen und Bürger für den Eintritt in einen fremden Militärdienst bestraft oder nicht, ist somit keine neutralitätsrechtliche und keine völkerrechtliche Frage. Es handelt sich hierbei um eine innere Angelegenheit des Schweizer Rechtsstaates, die in voller Eigenständigkeit entschieden werden kann.
Akt der Gerechtigkeit
Abschliessend möchte ich nochmals betonen: Eine Amnestie für die Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfer legalisiert nicht ihr Handeln. Sie führt lediglich zu einem Verzicht auf Verfolgung und Bestrafung durch die Schweizer Militärjustiz aufgrund ihres Eintritts in den Militärdienst für die Ukraine.
Dies unterscheidet meine Parlamentarische Initiative von den anderen Initiativen, die Sie heute behandeln. Diese fordern Rehabilitierungen, nicht Amnestien. Ebenso unterscheidet sich meine Initiative vom Beschluss unseres Parlaments bezüglich der Spanienkämpferinnen und -kämpfern der 1930er Jahre. Diese wurden 2009 – ich meine zu Recht – rehabilitiert.
Rehabilitierung bedeutet, dass vergangene Verurteilungen aufgehoben werden. Amnestie bedeutet, dass in der Gegenwart auf Verfolgung und Bestrafung verzichtet wird.
Die Spanienkämpferinnen und -kämpfer baten 1939 um eine Amnestie. Sie erhielten jedoch keine und mussten zum Teil harte Strafen verbüssen. Erst 70 Jahre später, als viele von ihnen bereits verstorben waren, erfolgte die Rehabilitierung. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, heute nicht denselben Fehler zu wiederholen.
Wir können und und wir sollten den Ukrainekämpferinnen und -kämpfern im Hier und Jetzt «kollektiv verzeihen», wie es im Kommentar zu unserer Verfassung so schön steht. Wir können und wir sollten auf eine Bestrafung dieser Bürgerinnen und Bürger verzichten. Es wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Denn sie riskieren ihr Leben für schweizerische, europäische und demokratische Werte.
Diesen Text habe ich in leicht veränderter Form am 14. Februar 2025 als Votum vor der Rechtskommission des Nationalrates gehalten.

Der Bundesrat hat die Verhandlungen mit der Europäischen Union abgeschlossen. Gut so, die SGA gratuliert. Noch nicht ausgehandelt sind hingegen die innenpolitischen Begleitmassnahmen. Das ist bedauerlich, denn diese werden letztlich entscheiden, ob eine Mehrheit für das Vertragspaket gewonnen und so der bilaterale Weg weitergeführt werden kann. Der Abschluss der Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel ist aber zweifellos ein wichtiger Schritt hin zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union. Das stimmt optimistisch!
Die Auseinandersetzung im Parlament und der Abstimmungskampf werden eine Herausforderung. Und natürlich werden die fundamentalen Gegner jeglicher Zusammengehörigkeit der Schweiz zu Europa ihre isolationistische Propagandawalze ausfahren. Sie werden die Phase der innenpolitischen Diskussionen nutzen, um die EU als bedrohlichen Feind hinzustellen, der die Schweiz gängeln will. Deshalb gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und in der öffentlichen Debatte immer wieder ein paar einfache Grundsätze festzuhalten:
- Partnerschaft: Die EU ist nicht unsere Gegnerin, sondern unser Nachbarin und unser eigentlicher Heimmarkt. Die neuen Verträge bedeuten keine «Unterwerfung», wie die Gegner sagen, sondern eine Fortsetzung der bilateralen Partnerschaft. Der Bilateralismus ist keineswegs der Liebling der EU, sondern derjenige der Schweiz. Wir haben der EU diese Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgezwungen, weil sie der Schweiz bestmögliche Bedingungen erlaubt: eine Partnerschaft auf Augenhöhe, sicherer Marktzugang, grösstmögliche Selbstbestimmung. Auch konservative Geister bejubeln den bilateralen Weg darum als «Königsweg». Schweizerischer geht es nicht!
- Rechtssicherheit: Bei den «institutionellen Fragen» im Vertragswerk geht es um Rechtssicherheit, und die gehört in jedem Staat und jeder internationalen Vereinbarung zur fundamentalen Grundausstattung. Im Verhältnis Schweiz-EU hat sie bisher gefehlt, jetzt kommt sie mit der ausgeklügelten Streitbeilegung endlich. Und wie in jedem bilateralen oder multilateralen Vertrag wird als letzte Instanz ein paritätisch besetztes Schiedsgericht vorgesehen. Ein verrechtlichtes Verhältnis ist immer im Interesse der kleineren Partnerin, also der Schweiz.
- Souveränität: Die bestehenden bilateralen Verträge sind «statisch». Sie halten einen Zustand beim Abschluss fest und können nur durch mühselige Verhandlungen von Fall zu Fall angepasst werden. Neu werden die Verträge «dynamisiert». Das heisst, dass ihre Aktualisierung endlich zum Normalfall wird. Das ist weit besser als die bisherige laufende Entwertung durch Stillstand. «Dynamisch» bedeutet aber nicht «automatisch». Dynamisch heisst: Wir können zu einer von der EU beschlossenen Neuerung Ja oder Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, kann die EU als Vertragspartnerin verhältnismässige Kompensation verlangen (Ausgleichsmassnahmen). Ob eine allfällige Ausgleichsmassnahme wirklich verhältnismässig ist, kann die Schweiz vom paritätischen Schiedsgericht überprüfen lassen. So geht Souveränität!
- Wohlstand: Wichtige Bereiche wie das Gesundheitswesen, das Baugewerbe oder die Gastronomie würden ohne die Arbeitskräfte aus der EU kollabieren. Die europäischen Einwanderinnen und Einwanderer zahlen Steuern und zahlen mehr in die Schweizer Sozialwerke ein, als sie von ihnen beziehen. Die Personenfreizügigkeit ist unter dem Strich eine Garantin für das Funktionieren und den Wohlstand der Schweiz. Zudem ist sie keine Einbahn-Strasse: In der EU leben so viele Schweizerinnen und Schweizer wie in der ganzen Ostschweiz.
- Patriotismus: Patriotismus ist nicht dasselbe wie Nationalismus. Patriotismus bedeutet, das eigene Land zu lieben. Nationalismus bedeutet, auf andere Länder hinunterzublicken, sie gar zu verachten. Wer patriotisch handeln will, setzt sich dafür ein, dass die Schweiz ein geregeltes Verhältnis zu ihren Nachbarn hat. Denn nur gute Nachbarschaft und geregelte Beziehungen ermöglichen es unserem Land, seine Zukunft und die unseres Kontinents zu gestalten. Die grossen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich ohnehin nur im Verbund europäischer Staaten und Gesellschaften lösen. Isolation und nationalistische Überheblichkeit schaden hingegen unserem Land und seiner Handlungsfähigkeit und sind darum unpatriotisch.
Die SGA wird sich weiterhin für eine sachliche und differenzierte Europadebatte einsetzen. Es ist legitim und notwendig, um die bestmöglichen innenpolitischen Begleitmassnahmen zum Beispiel in den Bereichen Lohnschutz, Service public oder Zuwanderung zu ringen. Gleichzeitig sollten wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dieses Ziel ist eine geregelte Beziehung der Schweiz mit der EU. Sie ist Voraussetzung für die Zukunftsgestaltung in unserem Land und auf unserem Kontinent. Mit dem Abschluss der Verhandlungen mit Brüssel ist dem Bundesrat ein wichtiger Schritt vorwärts gelungen.
Dieser Text ist am 20. Dezember 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

Der New Yorker Verkehrsexperte Lewis Mumford wusste schon vor 70 Jahren: Mehr Strassen bauen ist wie «seinen Hosengürtel öffnen, um Übergewicht loszuwerden». Wer die Strassen ausbaut, schafft mehr Verkehr. Das ist wissenschaftlich belegt. In der Fachsprache heisst das Phänomen «induzierte Nachfrage». Eine Vergrösserung des Angebots führt dazu, dass dieses stärker genutzt wird als vorher – sodass die erweiterten Kapazitäten der grösseren Nachfrage schon bald wieder nicht mehr gewachsen sind.
Die Schweizer Bevölkerung wusste das schon 1994. Damals nahm sie gegen den Willen von Bundesrat und Parlament die Alpeninitiative an und verbot so den Ausbau der Transitstrassen-Kapazitäten in den Schweizer Alpen. Die Mechanismen am Gotthard und am San Bernardino sind die gleichen wie am Gubrist und am Baregg. Wir alle können sie beobachten: Zusätzliche Spuren verschieben den Stau kurzfristig zu neuen Engpässen und ziehen mittelfristig noch mehr Autos und Lastwagen an. Das Problem wird verschärft statt gemildert.
Umso unverständlicher ist, dass Bundesrat Albert Rösti einen rund fünf Milliarden Franken teuren Ausbau des Nationalstrassennetzes in den Regionen Bern, St. Gallen, Basel, Schaffhausen und Genfersee propagiert. Glaubt er der Wissenschaft nicht? Verstehen er und die anderen Anhänger dieser Vorlage das Prinzip der induzierten Nachfrage nicht? Oder ist die Strassenlobby einfach so mächtig, dass die Mehrheit der Berner Politik Fachargumente in den Wind schlägt? Auf jeden Fall nimmt sie in Kauf, dass noch mehr Verkehr und Lärm unsere Dörfer und Quartiere belasten.
Auch klimapolitisch steht der Autobahnausbau völlig quer in der Landschaft. Mit der deutlichen Annahme des Klimaschutzgesetzes durch das Volk im Juni 2023 hat sich unser Land verpflichtet, die Emissionen des Verkehrs bis 2040 um 57 Prozent und bis 2050 um 100 Prozent zu reduzieren. Der Autobahnausbau und der damit verbundene Mehrverkehr stehen im kompletten Widerspruch zu diesen Zielwerten und würden deren Erreichung erschweren. Sogar der Bundesrat gibt in seinem Bericht zu, dass der Autobahnausbau die klimaschädlichen CO₂-Emissionen erhöhen würde. Dabei ist der Verkehr schon heute für einen Drittel der Emissionen in der Schweiz verantwortlich!
Mit einem Nein am 24. November können wir diesen Unsinn stoppen. Im Interesse unserer Lebensqualität, des haushälterischen Umgangs mit unserem Boden und des Klimaschutzes sollten wir dies unbedingt tun. Nur ein Nein bietet die Chance für eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik.
Es liegt im Interesse aller, gerade auch derjenigen, die täglich auf das Auto angewiesen sind, dass der Anteil des Autoverkehrs reduziert und mehr Mobilität auf den ÖV für längere und auf das Velo für kürzere Strecken verlagert wird. Um die vorhandenen grossen Strassenkapazitäten optimal zu nutzen und Staus zu vermeiden, sind die Verkehrsspitzen zu brechen. Ein effizientes und intelligentes System der Verkehrssteuerung sowie eine moderne Arbeitsorganisation mit flexibleren Arbeitszeiten können dabei helfen. Nutzen wir also die Chancen der Digitalisierung statt noch mehr teure Autobahnen zu bauen, die nur noch mehr Verkehr generieren.
Dieser Text ist am 30. Oktober 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.
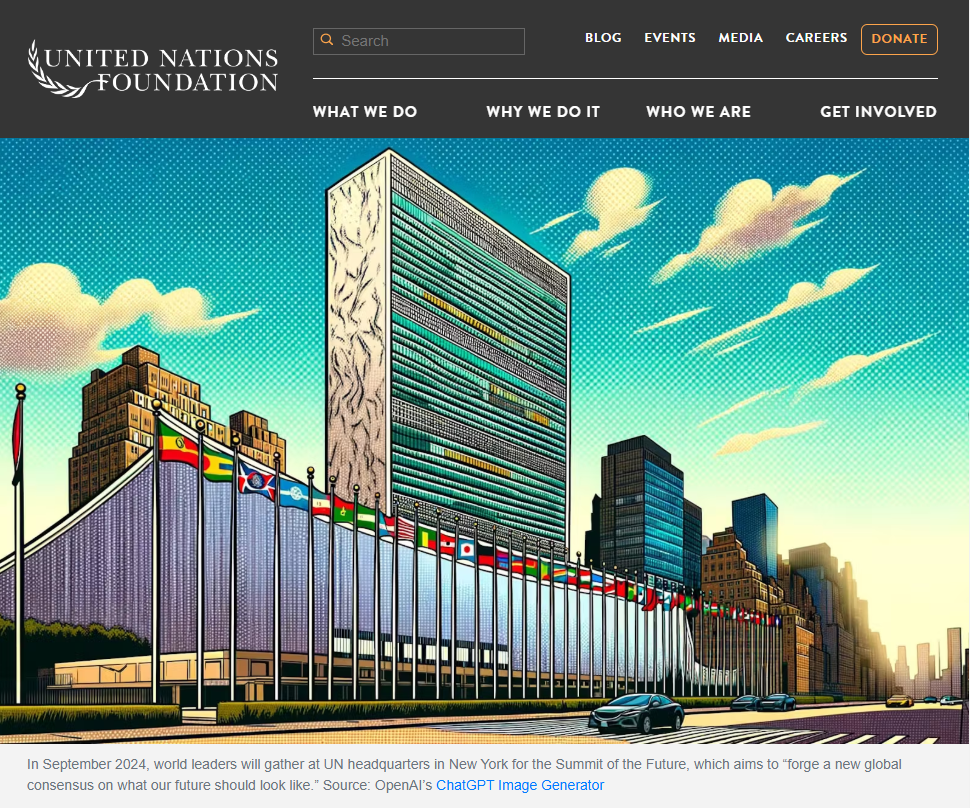
Die leider erstarkte Machtpolitik und die damit einhergehende Schwäche des Multilateralismus und des Völkerrechts blockieren die dringend notwendigen Fortschritte für Frieden und Wohlfahrt auf der Welt. Und dies, obwohl der Frieden sowie eine nachhaltige Entwicklung das erklärte Ziel der UNO und damit der internationalen Gemeinschaft wären. Doch in der globalen Realität erleben wir bittere Armut inmitten des Überflusses, wachsende Ungleichheit zwischen und innerhalb der Staaten, immer dramatischere Umweltkrisen auf allen Kontinenten sowie viele äusserst blutige Kriege und Konflikte.
Um das Steuer herumzureissen, hat UNO-Generalsekretär António Guterres für den 22. September einen Zukunftsgipfel aller 193 Mitgliedstaaten einberufen, der im Rahmen der 79. UNO-Generalversammlung in New York stattfinden wird. Die Schweiz wird von Bundespräsidentin Viola Amherd vertreten, die auch eine Rede am Zukunftsgipfel halten wird.
Das wohl zu ambitionierte Ziel des Gipfels ist es, einen internationalen Konsens für eine bessere Zukunft zu schaffen. Denn eigentlich sollte allen klar sein, dass die herkulischen Herausforderungen der Menschheit nur gemeinsam gemeistert werden können. Die Welt ist so komplex geworden, dass selbst Grossmächte wie die USA oder China eigentlich auf einen funktionierenden Multilateralismus angewiesen wären. Doch sind diese bereit, sich dafür einzusetzen?
Auf jeden Fall ist die Reform der UNO-Architektur neben der nachhaltigen Entwicklung, dem Frieden, der Beherrschung neuer Technologien und der Befähigung der Jugend eines der fünf Hauptthemen des Zukunftsgipfels. Auch die Schweiz hat die Reform der UNO zu einem ihrer Schwerpunkte für die Zeit ihrer Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat erklärt. Dabei konzentrieren sich unsere Diplomatinnen und Diplomaten auf pragmatische kleine Schritte für einen handlungsfähigeren, wirksameren und breiter abgestützten Sicherheitsrat.
Die Schweiz engagiert sich für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht und für den Einbezug von Nicht-Mitgliedern in die Arbeit des Gremiums. Damit sollen Konsenslösungen gefunden und Blockaden möglichst vermieden werden. Weiter sollen bessere Verfahrensgarantien die Effizienz der vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stärken und damit auch dessen Glaubwürdigkeit erhöhen. Das ist sicher alles richtig und verdienstvoll, doch angesichts der riesigen Herausforderungen der Weltgemeinschaft brauchen die UNO und der Multilateralismus deutlich ambitioniertere Reformschritte. Diesbezüglich dürfte sich die Schweiz, namentlich der Bundesrat, klarer vernehmen lassen.
Der Schlüssel zur Revitalisierung des Multilateralismus liegt darin, die UNO-Institutionen zu stärken, indem man sie repräsentativer und demokratischer macht. Heute ist die UNO zu sehr von wenigen mächtigen Staaten abhängig. Das bekannteste Problem ist die Vetomacht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Wenn diese fünf ihren Beitrag nicht leisten oder sich nicht einig sind – was in der heutigen Zeit hoher geopolitischer Spannung fast immer der Fall ist – wird das gesamte UNO-System geschwächt. Die sehr wünschbare Abschaffung der Vetomacht dürfte zwar am Veto der Machthaber scheitern. Doch es gibt weitere Reformideen, die auch von der Schweiz vorangetrieben werden sollten. Hier sind drei davon.
Erstens: Indien und Afrika in den Sicherheitsrat
Zum Beispiel könnte Indien ständiges Mitglied des Sicherheitsrats werden. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, die drittgrösste Volkswirtschaft und eine Atommacht. Im Jahr 1945 war das riesige Land noch eine britische Kolonie. Es hätte darum auch die Glaubwürdigkeit, den post-kolonialen Globalen Süden im einflussreichsten Gremium der UNO zu vertreten. Die Schweiz könnte also nebst der Stärkung ihres eigenen Handels mit Indien auch die politische Ambition dieses Landes innerhalb der UNO unterstützen. Zudem sollte auch der afrikanische Kontinent mindestens einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat erhalten, den zum Beispiel die Afrikanische Union selbst bestimmen könnte. Angesichts des Überhangs des Globalen Nordens im Sicherheitsrat wäre das mehr als angebracht. Und es wäre zweckmässig, wenn man bedenkt, dass der afrikanische Kontinent Schauplatz der meisten Konflikte und damit Hauptthema des Rats ist. Auch dafür könnte sich eine mutige Schweiz einsetzen.
Zweitens: Steuern für die UNO
Auch eine neue Finanzierung der UNO würde dem Multilateralismus die dringend benötigte politische Kraft verleihen. Die multilateralen Institutionen könnten zum Beispiel mit global erhobenen Steuern auf CO2-Emissionen, auf der internationalen Schiff- und Luftfahrt oder auf transnationalen Finanztransaktionen unabhängig und zuverlässig finanziert werden. Damit würde die UNO weniger abhängig von den Beiträgen der einzelnen Regierungen, was ihre Fähigkeit zur globalen Gouvernanz deutlich stärken würde. Ist die steuerpolitisch meist konservative Schweiz bereit, solche Ideen zu unterstützen?
Drittens: Eine parlamentarische UNO-Versammlung
Eine dritte Reformidee ist die Einrichtung einer parlamentarischen Versammlung der UNO. In der Generalversammlung hat jeder Mitgliedstaat eine Stimme und diese liegt in den Händen der jeweiligen Regierung. Diese erste Kammer könnte durch ein UNO-Parlament als zweite Kammer ergänzt werden. Diese würde die Völker der Welt vertreten, nicht deren Regierungen. Auch diesbezüglich könnte sich die Schweiz am Zukunftsgipfel deutlich verlauten lassen.
Letztlich ist der Zukunftsgipfel von António Guterres vor allem eine Einladung zu einem globalen Brainstorming. Einem gemeinsamen Nachdenken und Diskutieren darüber, wie unsere stark vernetzte und äusserst vulnerable Welt organisiert werden könnte, damit der Frieden und die nachhaltige Entwicklung auch tatsächlich eine Chance erhalten. Die Schweiz sollte in New York nicht nur als Musterschülerin der kleinen Schritte in Erscheinung treten. Sie sollte sich auch mit mutigen Reformideen in die Diskussion werfen.
Dieser Text ist am 20. September 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.