
«Let’s drink to the hard working people, let’s drink to the salt of the earth», singt Mick Jagger in der legendären Working-Class-Hymne der Rolling Stones. Als agnostischer Mensch habe ich gewisse Hemmungen, Bibelzitate zu bemühen. Und doch finde ich: Jagger und die Stones haben recht.
Die hart arbeitenden Menschen schaffen die Werte unserer Wirtschaft. Sie sorgen für Fortschritt und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Durch sie entstehen Würde und Zusammenhalt unter den Menschen.
Die Bähnlerinnen und Chauffeure, die Kindergärtner und Lehrerinnen, die Verkäuferinnen und Lageristen, die Elektroinstallateure und Polizistinnen, die Pflegerinnen und Bauarbeiter, die Sozialarbeiter und Sanitärinnen, die Köche und Apothekerinnen, die Sekretärinnen und Strassenkehrer – sie alle und viele mehr sorgen tagtäglich dafür, dass unser Leben funktioniert. Mit ihrer Erwerbsarbeit einerseits, mit unbezahlter Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit andererseits. Sie sind tatsächlich das Salz der Erde – und das Fundament jeder Gesellschaft.
Denn wir wissen es eigentlich alle: Wenn für eine Woche alle CEOs, Verwaltungsrätinnen oder auch Regierungsrätinnen und Parlamentarier, Bundesrätinnen und Stadtpräsidenten ausfallen, passiert – nichts. Aber wenn für eine Woche alle Pflegerinnen oder Bähnler ausfallen – dann steht das Land still oder sogar am Abgrund.
Deshalb feiern wir die hart arbeitenden Menschen und ihre Arbeit jedes Jahr am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Und an den übrigen 364 Tagen im Jahr setzen wir uns dafür ein, dass Arbeit endlich den Respekt bekommt, den sie verdient – mit Solidarität im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik.
Ein Wort zur Politik: Bitte tut alles, damit Simon Stocker auch den dritten Wahlgang am 29. Juni gewinnt und wieder in den Ständerat gewählt wird. Wir brauchen Simon in Bern, die soziale Schweiz braucht Simon im Stöckli!
Wie ihr wisst, ist der 1. Mai der einzige wirklich globale Feiertag. Denn der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter um Würde, Freiheit und Gerechtigkeit ist ein weltweiter – und zugleich ein Kampf für die Demokratie. Denn Demokratie ist weit mehr als ein politisches Verfahren. Sie ist die Idee einer Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleich sind. In der niemand wegen seines Berufs, Einkommens, Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, Herkunft, Religion oder Denkens weniger Rechte hat als andere. In der niemand über andere herrscht und niemand sich unterwerfen muss. In der kein König, kein Autokrat, keine Oligarchen und keine Milliardäre über das Leben der Menschen bestimmen.
Genau deshalb fürchten die Trumps, Putins, Xis, Erdogans, Orbans – aber auch die Musks, Bezos und Zuckerbergs – die Gewerkschaften und andere Demokratiebewegungen. Denn gemeinsamer Einsatz für gerechte Arbeitsbedingungen und für gleiche Rechte für alle – also gelebte Solidarität – entzieht ihrer Herrschaft und Hetze die Grundlage. Die Werte des 1. Mai sind das stärkste Schutzschild gegen Autokratie und Oligarchie und deshalb heute besonders wichtig.
Denn leider ist der Ernstfall eingetreten: Eine aggressive Grossmachtpolitik ist zurück. Und die Grossmächte dieser Welt arbeiten aktiv gegen Demokratie, Völkerrecht und Menschenrechte – nach innen genauso wie nach aussen.
China ist ein totalitärer Staat, der alles, jede und jeden überwacht und jeden Widerspruch brutal unterdrückt. Russland ist eine faschistische Gangsterdiktatur, die die demokratische Ukraine vernichten und die europäische Einigung zerschlagen will. Und unter Trump liegt nun auch die älteste Demokratie der Welt auf der Intensivstation. Seine permanente Lügenpropaganda, die tägliche Hetze, die Säuberungen in der Bundesverwaltung, die illegalen Massendeportationen, die Missachtung von Justiz und Gewaltenteilung, der rassistische und antifeministische Backlash, die Angriffe auf die freien Medien, die Wissenschaft, Andersdenkende und Minderheiten – sie zeigen die pure Zerstörungswut von Trump und seiner MAGA-Gefolgschaft.
Auch sein absurder Zollkrieg dient weniger wirtschaftlicher Logik als politischem Kalkül. Es wird zum Glück kaum erfolgreich sein, aber Trumps Ziel ist klar: Er will Handelspartner und amerikanische Wirtschaftsakteure gängeln und unterwerfen. Nur wer ihm Loyalität verspricht, darf auf Milde hoffen – das nennt er dann zynisch einen «Deal». Wer sich nicht beugen will, soll hingegen bluten. Diese Methode der wirtschaftlichen Erpressung ist altbekannt – die Mafia nennt das «Schutzgeld», Diktatoren wie Mussolini nannten es «Dirigismus».
Aber auch aussenpolitisch kennt Trump sprichwörtlich keine Grenzen. Genauso wie Xi Taiwan annektieren will, wie Putin die freie Ukraine bombardiert und sie als unabhängiger und demokratischer Staat beseitigen will, beansprucht Trump Panama, Grönland und Kanada für sich. Gaza will er ethnisch säubern lassen und dann eine amerikanische Riviera errichten. Und genau wie Putin will er die EU auseinanderdividieren.
Am schlimmsten aber ist eine Entscheidung Trumps, über die kaum gesprochen wird: die Abschaffung von USAID, der US-Entwicklungsagentur. Das wird Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen das Leben kosten. USAID stellte über 30% der weltweiten humanitären Hilfe bereit. Die Einstellung des Malariaprogramms allein wird laut Schätzungen bis zu 160’000 Menschen, vor allem Kinder, das Leben kosten. Ähnlich dramatisch sind die Folgen für HIV-Behandlungen oder Masernimpfungen. Das ist nicht nur menschenverachtend – das ist kriminell.
Und was macht die Schweizer Politik? Die SVP und FDP empören sich, wenn wir Trumps Politik als das bezeichnen, was sie ist: autoritär, imperialistisch, neofaschistisch. Zugleich biedert sich der Bundesrat in Washington an – und wird von Teilen der Medien auch noch dafür gefeiert. Die FDP fordert angesichts des Zollkriegs ein neoliberales Sparprogramm, die SVP übernimmt Trumps unmenschliche Migrationspolitik, seine Klimaleugnung, seine Verachtung für das Völkerrecht und seine Hetze gegen Europa.
Dagegen müssen wir Widerstand leisten. Auch hier in Schaffhausen und hier in der Schweiz. Gegen den kulturellen Backlash des Trumpismus. Gegen die prinzipienlose Politik des Bundesrats. Gegen den Sozialabbau. Gegen die Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit. Gegen die Hetze gegen Migrant:innen.
Dabei wissen wir, was der wirkungsvollste Widerstand ist: solidarisches Engagement. Für eine soziale Schweiz, mit fairen Löhnen, guten Arbeitsbedingungen und gerechten Renten. Für einen starken Service public. Für bezahlbare Mieten und Krankenkassenprämien. Für echte Gleichstellung, eine gerechte Klimapolitik, eine zeitgemässe Familienpolitik. Für den Zusammenhalt in Europa und eine verlässliche Beziehung der Schweiz zur EU. Für eine Schweiz, die sich mit anderen Demokratien gegen den Imperialismus und für das Völkerrecht einsetzt. Für eine Schweiz, die die Werte des 1. Mai lebt und stark macht – jeden Tag.
Doch woher nehmen wir die Kraft für diesen Widerstand und die Hoffnung für dieses Engagement? Wie verzweifeln wir nicht angesichts der Weltlage?
Immer wenn ich selbst zweifle, denke ich an Yina.
Vor einem Jahr reiste ich mit Swissaid und Kolleg:innen aus dem Nationalrat nach Kolumbien. Obwohl das Land als «Post-Conflict» und «Middle-Income Country» gilt, sind Armut und Gewalt allgegenwärtig. Doch eine starke Zivilgesellschaft leistet Widerstand – für Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Wir lernten Yina Ortega Benitez kennen, heute 27 Jahre alt. Sie ist eine indigene Aktivistin. Als Jugendliche musste sie ihr Dorf verlassen, weil ihr Zwangsprostitution oder Zwangsrekrutierung in eine bewaffnete Gruppe drohten. Dank Swissaid konnte sie studieren, hat heute eine gute Arbeit – und engagiert sich politisch und mit Jugendarbeit für den Frieden. In der Schweiz wäre sie wohl bei der JUSO. Aber während sich hiesige Jusos recht sicher politisch betätigen können, muss sich Yina immer wieder verstecken – ihr Leben ist tagtäglich bedroht. Die bewaffneten Gruppen wollen verhindern, dass sie weiteren Jugendlichen hilft, der Gewalt zu entkommen.
Doch Aufgeben ist für Yina keine Option. Nie. Mit Freund:innen kämpft sie weiter für Frieden und soziale Rechte. Ihre Organisation schreibt einen wundervollen Satz, den ich nie vergessen werde und der perfekt zum 1. Mai passt:
«Frieden ist nicht die Abwesenheit von bewaffnetem Konflikt – Frieden herrscht erst, wenn die Menschen ein Recht auf Bildung, auf gute Arbeit, auf Sicherheit und auf Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit haben.»
Unsere Gedanken sind heute bei allen Yinas dieser Welt.
Freiheit, Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenrechte – das sind die Werte des 1. Mai, weltweit. Sie sind unsere Hoffnung für eine bessere Zukunft. Aber sie kommen nicht von allein. Wir müssen sie erkämpfen. Am 1. Mai – und an jedem anderen Tag.
Es lebe der 1. Mai – hoch die internationale Solidarität!
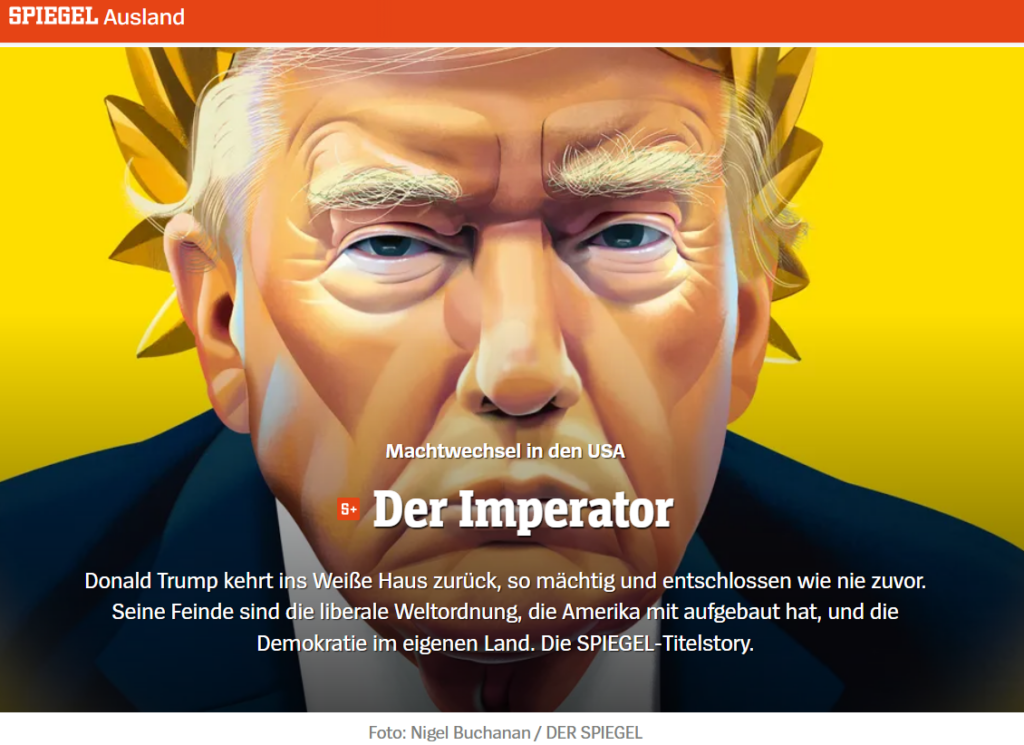
Donald Trump hat letzte Woche der Welt – und damit auch der Schweiz – den Wirtschaftskrieg erklärt. Dabei geht es ihm nicht primär um das Wohl der amerikanischen Wirtschaft, zumal diese unter den inflationstreibenden Zöllen schwer leiden wird. Der Börsenabsturz lässt grüssen. Es geht dem Herrscher im Weissen Haus um autoritäre Machtausübung. Mit seinen willkürlichen Zöllen versucht er, die Handelspartner und die amerikanischen Wirtschaftsakteure zu unterwerfen. Nur wer massive Konzessionen macht und ihm bedingungslose Loyalität garantiert, darf auf etwas Milde hoffen. Das nennt er dann «Deal». Wer sich nicht beugt, soll hingegen bluten. Trumps handelspolitischer Amoklauf zielt darauf ab, Gehorsam zu belohnen und Widerstand zu bestrafen.
Diese Methode der wirtschaftspolitischen Erpressung ist nicht neu. Die Mafia wendet sie mit den Schutzgeldern seit jeher an. Und auch Diktatoren haben Zölle immer wieder als Machtinstrument missbraucht. Zum Beispiel erzwang Benito Mussolini damit die Loyalität der italienischen Industriellen. Zuerst erhöhte er die Zölle für alle, um dann denjenigen Entlastung zu gewähren, die das faschistische Regime stützten.
Nach dem Leugnen der Wahlniederlage von 2020, den Begnadigungen der Putschisten vom 6. Januar, den ständigen Angriffen auf den Rechtsstaat und den willkürlichen Säuberungen in der Staatsverwaltung zeigt nun auch die Handelspolitik, wes Geistes Kind der amerikanische Präsident ist. Wer Donald Trump weiterhin nur als exzentrischen «Dealmaker» sieht, statt seine aggressiven Absichten zu durchschauen, geht ihm auf den Leim und missachtet damit die Interessen und Werte der Schweiz.
Die von der SVP und der FDP verfolgte Strategie der Anbiederung an Trump ist krachend gescheitert. Dass die Bundespräsidentin als einzige europäische Spitzenpolitikerin die Anti-Europa-Hetzrede von Vizepräsident JD Vance in München als «liberal» und «schweizerisch» lobte, bleibt als Peinlichkeit in Erinnerung. Genauso wie die grotesken Aussagen von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, die Trump als Segen für die Wirtschaft und grossen Freund der Schweiz bezeichnete.
Es ist höchste Zeit für einen Strategiewechsel, denn die Lage ist sehr ernst. Das Zeitalter der Grossmachtpolitik ist leider zurück. Damit sich die Schweiz als demokratischer Kleinstaat behaupten kann, braucht es eine prinzipienfeste politische Führung. Genauso wie man sich der Mafia nicht beugt, dürfen wir uns auch nicht vor Trump in den Staub werfen. Wir brauchen keine Anbiederung, wir brauchen Verbündete.
Wenn imperiale Mächte wie Russland, China und die USA die Welt durch Krieg, aggressive Aussenpolitik oder wirtschaftliche Erpressung in Einflusszonen aufteilen wollen, kann die Schweiz nicht länger «zwischen den Blöcken navigieren», wie es die Bundespräsidentin ausdrückte. Unsere Sicherheit und unser Wohlstand können nur im europäischen Verbund gesichert werden. Nur zusammen mit der Europäischen Union und anderen demokratischen Staaten wie dem Vereinigten Königreich und Kanada können wir unsere Souveränität in dieser gefährlichen Welt behaupten. Der erste Schritt dazu ist ein rasches Ja zum Vertragspaket mit der Europäischen Union.
Dieser Text ist am 9. April 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Dem Bundesrat gebührt Lob für seine klare Haltung und seinen Mut in der Europapolitik. Im Dezember hat er erfolgreich die Verhandlungen mit Brüssel abgeschlossen, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu stabilisieren. Letzten Freitag hat er dann auch die von den Sozialpartnern ausgehandelten Massnahmen zur Sicherung des Lohnschutzes vorgestellt. Zeitgleich stellte er klar, dass die SVP-Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit einen direkten Angriff auf die bilateralen Verträge darstellt und die Schweiz in Europa isolieren würden.
Die Auseinandersetzung im Parlament und dann im Abstimmungskampf werden trotzdem herausfordernd. Die eingefleischten EU-Gegner werden ihre isolationistische Propagandawalze ausfahren. Sie werden die EU als bedrohliche Macht darstellen. Obwohl dieses Zerrbild unserer friedlichen Nachbarstaaten angesichts der realen Bedrohungen aus Putins Russland und Trumps Amerika absurd ist. Umso wichtiger ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und der interessierten Öffentlichkeit fünf grundsätzliche Punkte in Erinnerung zu rufen.
- Partnerschaft: Die EU ist nicht unsere Gegnerin, sondern unsere Nachbarin und unser eigentlicher Heimmarkt. Gerade in einer geopolitisch zerrütteten Welt ist ein sicherer Zugang zum Heimmarkt überlebenswichtig für unsere Wirtschaft. Die neuen Verträge bedeuten keine «Unterwerfung», wie die Gegner behaupten, sondern eine Fortsetzung der bilateralen Partnerschaft. Der Bilateralismus ist keineswegs der Liebling der EU, sondern derjenige der Schweiz. Wir haben der EU diese Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgezwungen, weil sie der Schweiz bestmögliche Bedingungen erlaubt: Partnerschaft auf Augenhöhe, sicherer Marktzugang, grösstmögliche Selbstbestimmung. Schweizerischer geht es nicht!
- Rechtssicherheit: Bei den «institutionellen Fragen» im Vertragswerk geht es um Rechtssicherheit. Diese gehört in jeder internationalen Vereinbarung zur Grundausstattung. Im Verhältnis Schweiz-EU hat sie bisher gefehlt, jetzt kommt sie mit einer ausgeklügelten Streitbeilegung endlich. Und wie in jedem bilateralen oder multilateralen Vertrag wird als letzte Instanz kein «fremder Richter», sondern ein paritätisch besetztes Schiedsgericht entscheiden. Streit wird also rechtlich und nicht mehr politisch beigelegt. Das ist ein Gewinn, weil ein verrechtlichtes Verhältnis immer im Interesse der kleineren Partnerin ist, also der Schweiz.
- Souveränität: Die bestehenden bilateralen Verträge sind «statisch». Sie halten einen Zustand beim Abschluss fest und können nur durch mühselige Verhandlungen von Fall zu Fall angepasst werden. Neu werden die Verträge «dynamisiert». Das heisst, dass ihre Aktualisierung endlich zum Normalfall wird. Das ist weit besser als die schleichende Entwertung durch Stillstand, welche wir heute haben. «Dynamisch» heisst aber nicht «automatisch». Dynamisch bedeutet: Wir können zu jeder von der EU beschlossenen Neuerung – souverän – Ja oder Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, kann die EU als Vertragspartnerin mit verhältnismässigen Ausgleichsmassnahmen Kompensation verlangen. Ob eine allfällige Ausgleichsmassnahme wirklich verhältnismässig ist, kann die Schweiz vom paritätischen Schiedsgericht überprüfen lassen.
- Wohlstand: Wichtige Branchen wie das Gesundheitswesen, die Industrie, das Baugewerbe oder die Gastronomie würden ohne die Arbeitskräfte aus der EU kollabieren. Die europäischen Einwanderinnen und Einwanderer zahlen Steuern und zahlen mehr in die Schweizer Sozialwerke ein, als sie von ihnen beziehen. Die Personenfreizügigkeit ist unter dem Strich eine Garantin für das Funktionieren und den Wohlstand der Schweiz. Dies gilt in noch höheren Mass für Graubünden. Zudem ist sie keine Einbahnstrasse: In der EU leben so viele Schweizerinnen und Schweizer wie in der ganzen Ostschweiz.
- Patriotismus: Patriotismus ist nicht dasselbe wie Nationalismus. Patriotismus bedeutet, das eigene Land zu lieben. Nationalismus bedeutet, auf andere Länder hinunterzublicken, sie gar zu verachten. Wer patriotisch handeln will, setzt sich dafür ein, dass die Schweiz ein geregeltes Verhältnis zu ihren Nachbarn hat. Denn nur gute Nachbarschaft und geregelte Beziehungen ermöglichen es unserem Land, seine Zukunft und die unseres Kontinents zu gestalten. Die grossen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich ohnehin nur im Verbund europäischer Staaten und Gesellschaften lösen. Isolation und nationalistische Überheblichkeit schaden hingegen unserem Land und seiner Handlungsfähigkeit und sind darum unpatriotisch.
Es ist völlig legitim und notwendig, um die bestmöglichen innenpolitischen Begleitmassnahmen in Bereichen wie Lohnschutz, Service public oder Zuwanderung zu ringen. Gute Lösungen in den Details des Gesamtpakets sichern am Ende dessen Mehrheitsfähigkeit. Gleichzeitig darf das übergeordnete Ziel nicht aus den Augen verloren werden: Eine geregelte Beziehung der Schweiz mit der EU. Sie ist die Grundlage für die Gestaltung unserer Zukunft und der Zukunft unseres Kontinents.
Spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind stabile Beziehungen zu Europa auch eine geostrategische Notwendigkeit für die Schweiz. Trumps Verrat an der Ukraine und damit auch an Europas Sicherheit, sein Appeasement gegenüber dem Aggressor Putin und seine eigenen imperialen Ambitionen sind auch für unser Land ein Weckruf. Mehr europäische Integration ist auch aus sicherheitspolitischen Gründen das Gebot der Stunde. In dieser gefährlichen Welt ist unsere Selbstbehauptung als Kleinstaat und damit unsere Souveränität nur im europäischen Verbund möglich.
Dieser Text ist als Gastkommentar im Bündner Tagblatt vom 27. März 2025 erschienen.

Trotz eines positiven Jahresabschlusses und einem Rückgang der ohnehin äusserst bescheidenen Bundesschulden beharrt der Bundesrat darauf, staatliche Leistungen weiter zu kürzen, was er euphemistisch «sparen» oder «entlasten» nennt. Die Begründung lautet, die Schweiz habe ein «Ausgabenproblem», weshalb die Schuldenbremse strikt durchgesetzt werden müsse. Dieses Argument ist schlicht falsch.
Der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Verkehr sagte kurz vor seiner Pensionierung, die Schuldenbremse sei in Bundesbern zum «Fetisch» geworden. Er hat recht. Die zu enge und dogmatische Auslegung der Schuldenbremse hat die Schweiz in ein finanzielles Korsett gezwängt, das die Handlungsfähigkeit des Staates einschränkt und mittelfristig den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt unseres Landes gefährdet.
Dabei sind die Schweizer Staatsfinanzen kerngesund. Seit Jahrzehnten liegt die Ausgabenquote des Bundes stabil bei etwa 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Wie kann von einem «Ausgabenproblem» die Rede sein, wenn sich die Bundesausgaben seit über 25 Jahren genau parallel zur Wirtschaftsleistung entwickeln? Die Schuldenquote des Bundes ist eine der niedrigsten weltweit und liegt bei nur 17,8 Prozent des BIP. Wer hier vor Überschuldung warnt, kennt entweder die tatsächlichen Zahlen nicht oder will der Bevölkerung Angst machen.
Obwohl die Staatsquote seit 25 Jahre stabil ist und die Schuldenquote sinkt, gibt es gute Gründe, warum sich dies ändern sollte. Putins Krieg hat den Ruf nach einer grösseren Armee verstärkt und gleichzeitig die Inflation angeheizt, was die Kaufkraft vieler Menschen geschwächt hat. Zu Recht hat die Bevölkerung eine 13. AHV-Rente beschlossen und erwartet Entlastung bei den Krankenkassenprämien. Zudem werden fundamentale öffentliche Güter wie Bildung und Gesundheit im Verhältnis zu Konsumgütern teurer, weil sie sich mit technischem Fortschritt nicht verbilligen lassen. Und nicht zuletzt erfordert die Klimakrise gewaltige Investitionen in die Energiewende und den Bevölkerungsschutz.
Der Bundesrat reagiert auf diese Herausforderungen aber mit massiven Kürzungen öffentlicher Leistungen. Das erste Opfer war die internationale Zusammenarbeit, insbesondere die Entwicklungs- und Friedenspolitik. Dieser Abbau inmitten einer gefährlicher werdenden Welt ist sicherheits- und aussenpolitisch verantwortungslos. Auch bei Bildung, Forschung, Klimaschutz, Biodiversität, öffentlichem Verkehr, Gleichstellung und vielen anderen Bereichen soll gekürzt werden. Diese Abbaupolitik gefährdet die Innovationsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt der Schweiz.
Dabei könnte eine flexiblere Handhabung der Schuldenbremse viele Probleme lösen. Ein Beispiel wäre die Integration der «goldenen Regel» der Staatsfinanzierung, die es erlaubt, Investitionen, die einen volkswirtschaftlichen Ertrag abwerfen, mindestens zu Teilen mit Neuverschuldung zu finanzieren. Denn zum Beispiel Infrastruktur, Forschung oder grüne Technologien erfordern jetzt Investitionen, die uns später auch finanziell zugutekommen.
Die Schweiz hat weder ein Ausgaben- noch ein Schuldenproblem. Wir werden jedoch ein Zukunftsproblem bekommen, wenn wir an einer zu starren Schuldenbremse festhalten und uns der nötigen Flexibilität verweigern. Ein Kurswechsel in der Finanzpolitik ist dringend nötig.
Dieser Text ist am 19. Februar 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Rechtskommission,
vielen Dank für die Möglichkeit, meine Parlamentarische Initiative zu präsentieren. Ihr Inhalt ist einfach und klar: Allen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, die in der Ukraine gegen die völkerrechtswidrige russische Aggression kämpfen, soll eine Amnestie gewährt werden. Diese Amnestie betrifft ausschliesslich Verstösse gegen Artikel 94 des Militärstrafgesetzes, der den Eintritt in fremden Militärdienst unter Strafe stellt. Für etwaige andere Straftaten, die im Rahmen des Krieges in der Ukraine begangen würden, gilt die Amnestie selbstverständlich nicht.
Zum Formellen
Die Kompetenz zur Gewährung von Amnestien liegt bei der Bundesversammlung. Diese Zuständigkeit ist eindeutig in Artikel 173 Absatz 1 lit. k der Bundesverfassung sowie in Artikel 232e des Militärstrafgesetzes verankert.
Laut dem St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung bedeutet Amnestie: «(…) den Verzicht des Staates auf Strafverfolgung oder Strafvollzug gegenüber einer bestimmten oder unbestimmten Vielzahl von Delinquenten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. (…) Anders als etwa das französische Recht hat sie (die Amnestie) jedoch nicht die Aufhebung oder Löschung begangener Delikte zur Folge. Die Amnestie ist der Sache nach ein ‘kollektives Verzeihen’ im Interesse des Staates.»
Es geht also nicht um die Aufhebung von Urteilen, sondern um den Verzicht auf Strafverfolgung und Strafvollzug. Es geht darum, den Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfern «kollektiv zu verzeihen.»
Zum öffentlichen Interesse
Die zentrale Frage ist nun: Liegt dieses kollektive Verzeihen im öffentlichen Interesse der Schweiz? Ich meine klar ja.
Schweizerinnen und Schweizer, die in der Ukraine, beispielsweise in der Internationalen Legion der Territorialverteidigung, gegen die russische Aggression kämpfen, verteidigen natürlich in erster Linie das Territorium und die Bevölkerung der Ukraine.
Auf einer übergeordneten Ebene verteidigen sie jedoch auch zentrale Werte und Grundsätze des Völkerrechts sowie des Schweizer Staates: Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität.
Die Grundsätze der Souveränität und der territorialen Integrität sind völkerrechtlich in der UNO-Charta und in der Schlussakte von Helsinki verankert, welche als eine Art Gründungsurkunde der OSZE gilt. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz soeben zwei Jahre im Sicherheitsrat der UNO vertreten war und ab nächstem Jahr die OSZE präsidieren wird, sind die Grundsätze von UNO und OSZE von grosser aussenpolitischer Bedeutung für die Schweiz und entsprechen damit einem hohen öffentlichen Interesse unseres Landes.
Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit ihrerseits sind Staatsziele der Schweiz, die im Zweckartikel 2 Absatz 1 der Bundesverfassung mindestens sinngemäss festgeschrieben sind.
Wenn wir die UNO-Charta, die Schlussakte von Helsinki und die Bundesverfassung konsultieren und gleichzeitig bedenken, dass die Ukraine einen legitimen Verteidigungskampf führt – während Russland eine illegale Aggression verübt! – stellen wir fest, dass der Kampf einzelner Schweizerinnen und Schweizer in der Verteidigung der Ukraine mit den Werten der Schweiz vereinbar ist.
Daher besteht aus meiner Sicht ein öffentliches Interesse daran, diese Schweizerinnen und Schweizer nicht dafür zu bestrafen. Obwohl es formell offenkundig ist, dass sie das Gesetz brechen.
Zur Neutralität
Die Neutralität ist kein Staatsziel der Schweiz. Der Verfassungsgeber hat bewusst auf eine Verankerung der Neutralität im Zweckartikel 2 oder in den aussenpolitischen Grundsätzen in Artikel 54 verzichtet.
Die Grundlage des Neutralitätsrechts ist also nicht die Bundesverfassung, sondern das Haager Abkommen von 1907. Die dort verankerten Pflichten der «neutralen Macht» gelten für den Staat, nicht für die individuelle Entscheidung einer Bürgerin oder eines Bürgers. Das Neutralitätsrecht verpflichtet den Staat auch nicht, seine eigenen Bürgerinnen und Bürger zu bestrafen, wenn diese in fremden Militärdienst eintreten.
Dies wird durch das Recht und die Praxis anderer neutraler Staaten belegt: So kennen etwa Österreich und Irland kein generelles Verbot für den Eintritt in fremden Militärdienst, obwohl sie genau wie die Schweiz neutrale Staaten sind. Auch Schweden und Finnland – die bis vor kurzem selbst als neutral galten – bestrafen seit jeher fremden Militärdienst nicht.
Artikel 6 des Haager Abkommens besagt sogar explizit: «Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, dass Einzelpersonen die Grenze überschreiten, um in den Dienst eines Kriegsführenden zu treten.»
Die Frage, ob die Schweiz einzelne Bürgerinnen und Bürger für den Eintritt in einen fremden Militärdienst bestraft oder nicht, ist somit keine neutralitätsrechtliche und keine völkerrechtliche Frage. Es handelt sich hierbei um eine innere Angelegenheit des Schweizer Rechtsstaates, die in voller Eigenständigkeit entschieden werden kann.
Akt der Gerechtigkeit
Abschliessend möchte ich nochmals betonen: Eine Amnestie für die Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfer legalisiert nicht ihr Handeln. Sie führt lediglich zu einem Verzicht auf Verfolgung und Bestrafung durch die Schweizer Militärjustiz aufgrund ihres Eintritts in den Militärdienst für die Ukraine.
Dies unterscheidet meine Parlamentarische Initiative von den anderen Initiativen, die Sie heute behandeln. Diese fordern Rehabilitierungen, nicht Amnestien. Ebenso unterscheidet sich meine Initiative vom Beschluss unseres Parlaments bezüglich der Spanienkämpferinnen und -kämpfern der 1930er Jahre. Diese wurden 2009 – ich meine zu Recht – rehabilitiert.
Rehabilitierung bedeutet, dass vergangene Verurteilungen aufgehoben werden. Amnestie bedeutet, dass in der Gegenwart auf Verfolgung und Bestrafung verzichtet wird.
Die Spanienkämpferinnen und -kämpfer baten 1939 um eine Amnestie. Sie erhielten jedoch keine und mussten zum Teil harte Strafen verbüssen. Erst 70 Jahre später, als viele von ihnen bereits verstorben waren, erfolgte die Rehabilitierung. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, heute nicht denselben Fehler zu wiederholen.
Wir können und und wir sollten den Ukrainekämpferinnen und -kämpfern im Hier und Jetzt «kollektiv verzeihen», wie es im Kommentar zu unserer Verfassung so schön steht. Wir können und wir sollten auf eine Bestrafung dieser Bürgerinnen und Bürger verzichten. Es wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Denn sie riskieren ihr Leben für schweizerische, europäische und demokratische Werte.
Diesen Text habe ich in leicht veränderter Form am 14. Februar 2025 als Votum vor der Rechtskommission des Nationalrates gehalten.

Der Bundesrat hat die Verhandlungen mit der Europäischen Union abgeschlossen. Gut so, die SGA gratuliert. Noch nicht ausgehandelt sind hingegen die innenpolitischen Begleitmassnahmen. Das ist bedauerlich, denn diese werden letztlich entscheiden, ob eine Mehrheit für das Vertragspaket gewonnen und so der bilaterale Weg weitergeführt werden kann. Der Abschluss der Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel ist aber zweifellos ein wichtiger Schritt hin zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union. Das stimmt optimistisch!
Die Auseinandersetzung im Parlament und der Abstimmungskampf werden eine Herausforderung. Und natürlich werden die fundamentalen Gegner jeglicher Zusammengehörigkeit der Schweiz zu Europa ihre isolationistische Propagandawalze ausfahren. Sie werden die Phase der innenpolitischen Diskussionen nutzen, um die EU als bedrohlichen Feind hinzustellen, der die Schweiz gängeln will. Deshalb gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und in der öffentlichen Debatte immer wieder ein paar einfache Grundsätze festzuhalten:
- Partnerschaft: Die EU ist nicht unsere Gegnerin, sondern unser Nachbarin und unser eigentlicher Heimmarkt. Die neuen Verträge bedeuten keine «Unterwerfung», wie die Gegner sagen, sondern eine Fortsetzung der bilateralen Partnerschaft. Der Bilateralismus ist keineswegs der Liebling der EU, sondern derjenige der Schweiz. Wir haben der EU diese Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgezwungen, weil sie der Schweiz bestmögliche Bedingungen erlaubt: eine Partnerschaft auf Augenhöhe, sicherer Marktzugang, grösstmögliche Selbstbestimmung. Auch konservative Geister bejubeln den bilateralen Weg darum als «Königsweg». Schweizerischer geht es nicht!
- Rechtssicherheit: Bei den «institutionellen Fragen» im Vertragswerk geht es um Rechtssicherheit, und die gehört in jedem Staat und jeder internationalen Vereinbarung zur fundamentalen Grundausstattung. Im Verhältnis Schweiz-EU hat sie bisher gefehlt, jetzt kommt sie mit der ausgeklügelten Streitbeilegung endlich. Und wie in jedem bilateralen oder multilateralen Vertrag wird als letzte Instanz ein paritätisch besetztes Schiedsgericht vorgesehen. Ein verrechtlichtes Verhältnis ist immer im Interesse der kleineren Partnerin, also der Schweiz.
- Souveränität: Die bestehenden bilateralen Verträge sind «statisch». Sie halten einen Zustand beim Abschluss fest und können nur durch mühselige Verhandlungen von Fall zu Fall angepasst werden. Neu werden die Verträge «dynamisiert». Das heisst, dass ihre Aktualisierung endlich zum Normalfall wird. Das ist weit besser als die bisherige laufende Entwertung durch Stillstand. «Dynamisch» bedeutet aber nicht «automatisch». Dynamisch heisst: Wir können zu einer von der EU beschlossenen Neuerung Ja oder Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, kann die EU als Vertragspartnerin verhältnismässige Kompensation verlangen (Ausgleichsmassnahmen). Ob eine allfällige Ausgleichsmassnahme wirklich verhältnismässig ist, kann die Schweiz vom paritätischen Schiedsgericht überprüfen lassen. So geht Souveränität!
- Wohlstand: Wichtige Bereiche wie das Gesundheitswesen, das Baugewerbe oder die Gastronomie würden ohne die Arbeitskräfte aus der EU kollabieren. Die europäischen Einwanderinnen und Einwanderer zahlen Steuern und zahlen mehr in die Schweizer Sozialwerke ein, als sie von ihnen beziehen. Die Personenfreizügigkeit ist unter dem Strich eine Garantin für das Funktionieren und den Wohlstand der Schweiz. Zudem ist sie keine Einbahn-Strasse: In der EU leben so viele Schweizerinnen und Schweizer wie in der ganzen Ostschweiz.
- Patriotismus: Patriotismus ist nicht dasselbe wie Nationalismus. Patriotismus bedeutet, das eigene Land zu lieben. Nationalismus bedeutet, auf andere Länder hinunterzublicken, sie gar zu verachten. Wer patriotisch handeln will, setzt sich dafür ein, dass die Schweiz ein geregeltes Verhältnis zu ihren Nachbarn hat. Denn nur gute Nachbarschaft und geregelte Beziehungen ermöglichen es unserem Land, seine Zukunft und die unseres Kontinents zu gestalten. Die grossen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich ohnehin nur im Verbund europäischer Staaten und Gesellschaften lösen. Isolation und nationalistische Überheblichkeit schaden hingegen unserem Land und seiner Handlungsfähigkeit und sind darum unpatriotisch.
Die SGA wird sich weiterhin für eine sachliche und differenzierte Europadebatte einsetzen. Es ist legitim und notwendig, um die bestmöglichen innenpolitischen Begleitmassnahmen zum Beispiel in den Bereichen Lohnschutz, Service public oder Zuwanderung zu ringen. Gleichzeitig sollten wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dieses Ziel ist eine geregelte Beziehung der Schweiz mit der EU. Sie ist Voraussetzung für die Zukunftsgestaltung in unserem Land und auf unserem Kontinent. Mit dem Abschluss der Verhandlungen mit Brüssel ist dem Bundesrat ein wichtiger Schritt vorwärts gelungen.
Dieser Text ist am 20. Dezember 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

Der New Yorker Verkehrsexperte Lewis Mumford wusste schon vor 70 Jahren: Mehr Strassen bauen ist wie «seinen Hosengürtel öffnen, um Übergewicht loszuwerden». Wer die Strassen ausbaut, schafft mehr Verkehr. Das ist wissenschaftlich belegt. In der Fachsprache heisst das Phänomen «induzierte Nachfrage». Eine Vergrösserung des Angebots führt dazu, dass dieses stärker genutzt wird als vorher – sodass die erweiterten Kapazitäten der grösseren Nachfrage schon bald wieder nicht mehr gewachsen sind.
Die Schweizer Bevölkerung wusste das schon 1994. Damals nahm sie gegen den Willen von Bundesrat und Parlament die Alpeninitiative an und verbot so den Ausbau der Transitstrassen-Kapazitäten in den Schweizer Alpen. Die Mechanismen am Gotthard und am San Bernardino sind die gleichen wie am Gubrist und am Baregg. Wir alle können sie beobachten: Zusätzliche Spuren verschieben den Stau kurzfristig zu neuen Engpässen und ziehen mittelfristig noch mehr Autos und Lastwagen an. Das Problem wird verschärft statt gemildert.
Umso unverständlicher ist, dass Bundesrat Albert Rösti einen rund fünf Milliarden Franken teuren Ausbau des Nationalstrassennetzes in den Regionen Bern, St. Gallen, Basel, Schaffhausen und Genfersee propagiert. Glaubt er der Wissenschaft nicht? Verstehen er und die anderen Anhänger dieser Vorlage das Prinzip der induzierten Nachfrage nicht? Oder ist die Strassenlobby einfach so mächtig, dass die Mehrheit der Berner Politik Fachargumente in den Wind schlägt? Auf jeden Fall nimmt sie in Kauf, dass noch mehr Verkehr und Lärm unsere Dörfer und Quartiere belasten.
Auch klimapolitisch steht der Autobahnausbau völlig quer in der Landschaft. Mit der deutlichen Annahme des Klimaschutzgesetzes durch das Volk im Juni 2023 hat sich unser Land verpflichtet, die Emissionen des Verkehrs bis 2040 um 57 Prozent und bis 2050 um 100 Prozent zu reduzieren. Der Autobahnausbau und der damit verbundene Mehrverkehr stehen im kompletten Widerspruch zu diesen Zielwerten und würden deren Erreichung erschweren. Sogar der Bundesrat gibt in seinem Bericht zu, dass der Autobahnausbau die klimaschädlichen CO₂-Emissionen erhöhen würde. Dabei ist der Verkehr schon heute für einen Drittel der Emissionen in der Schweiz verantwortlich!
Mit einem Nein am 24. November können wir diesen Unsinn stoppen. Im Interesse unserer Lebensqualität, des haushälterischen Umgangs mit unserem Boden und des Klimaschutzes sollten wir dies unbedingt tun. Nur ein Nein bietet die Chance für eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik.
Es liegt im Interesse aller, gerade auch derjenigen, die täglich auf das Auto angewiesen sind, dass der Anteil des Autoverkehrs reduziert und mehr Mobilität auf den ÖV für längere und auf das Velo für kürzere Strecken verlagert wird. Um die vorhandenen grossen Strassenkapazitäten optimal zu nutzen und Staus zu vermeiden, sind die Verkehrsspitzen zu brechen. Ein effizientes und intelligentes System der Verkehrssteuerung sowie eine moderne Arbeitsorganisation mit flexibleren Arbeitszeiten können dabei helfen. Nutzen wir also die Chancen der Digitalisierung statt noch mehr teure Autobahnen zu bauen, die nur noch mehr Verkehr generieren.
Dieser Text ist am 30. Oktober 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.
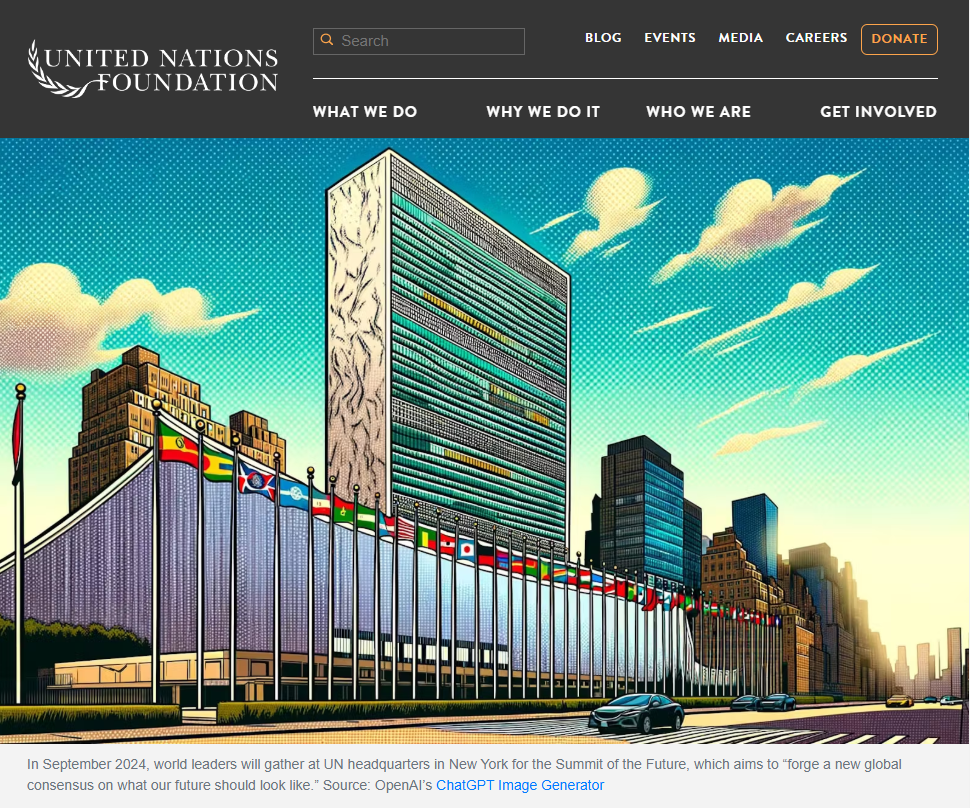
Die leider erstarkte Machtpolitik und die damit einhergehende Schwäche des Multilateralismus und des Völkerrechts blockieren die dringend notwendigen Fortschritte für Frieden und Wohlfahrt auf der Welt. Und dies, obwohl der Frieden sowie eine nachhaltige Entwicklung das erklärte Ziel der UNO und damit der internationalen Gemeinschaft wären. Doch in der globalen Realität erleben wir bittere Armut inmitten des Überflusses, wachsende Ungleichheit zwischen und innerhalb der Staaten, immer dramatischere Umweltkrisen auf allen Kontinenten sowie viele äusserst blutige Kriege und Konflikte.
Um das Steuer herumzureissen, hat UNO-Generalsekretär António Guterres für den 22. September einen Zukunftsgipfel aller 193 Mitgliedstaaten einberufen, der im Rahmen der 79. UNO-Generalversammlung in New York stattfinden wird. Die Schweiz wird von Bundespräsidentin Viola Amherd vertreten, die auch eine Rede am Zukunftsgipfel halten wird.
Das wohl zu ambitionierte Ziel des Gipfels ist es, einen internationalen Konsens für eine bessere Zukunft zu schaffen. Denn eigentlich sollte allen klar sein, dass die herkulischen Herausforderungen der Menschheit nur gemeinsam gemeistert werden können. Die Welt ist so komplex geworden, dass selbst Grossmächte wie die USA oder China eigentlich auf einen funktionierenden Multilateralismus angewiesen wären. Doch sind diese bereit, sich dafür einzusetzen?
Auf jeden Fall ist die Reform der UNO-Architektur neben der nachhaltigen Entwicklung, dem Frieden, der Beherrschung neuer Technologien und der Befähigung der Jugend eines der fünf Hauptthemen des Zukunftsgipfels. Auch die Schweiz hat die Reform der UNO zu einem ihrer Schwerpunkte für die Zeit ihrer Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat erklärt. Dabei konzentrieren sich unsere Diplomatinnen und Diplomaten auf pragmatische kleine Schritte für einen handlungsfähigeren, wirksameren und breiter abgestützten Sicherheitsrat.
Die Schweiz engagiert sich für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht und für den Einbezug von Nicht-Mitgliedern in die Arbeit des Gremiums. Damit sollen Konsenslösungen gefunden und Blockaden möglichst vermieden werden. Weiter sollen bessere Verfahrensgarantien die Effizienz der vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stärken und damit auch dessen Glaubwürdigkeit erhöhen. Das ist sicher alles richtig und verdienstvoll, doch angesichts der riesigen Herausforderungen der Weltgemeinschaft brauchen die UNO und der Multilateralismus deutlich ambitioniertere Reformschritte. Diesbezüglich dürfte sich die Schweiz, namentlich der Bundesrat, klarer vernehmen lassen.
Der Schlüssel zur Revitalisierung des Multilateralismus liegt darin, die UNO-Institutionen zu stärken, indem man sie repräsentativer und demokratischer macht. Heute ist die UNO zu sehr von wenigen mächtigen Staaten abhängig. Das bekannteste Problem ist die Vetomacht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Wenn diese fünf ihren Beitrag nicht leisten oder sich nicht einig sind – was in der heutigen Zeit hoher geopolitischer Spannung fast immer der Fall ist – wird das gesamte UNO-System geschwächt. Die sehr wünschbare Abschaffung der Vetomacht dürfte zwar am Veto der Machthaber scheitern. Doch es gibt weitere Reformideen, die auch von der Schweiz vorangetrieben werden sollten. Hier sind drei davon.
Erstens: Indien und Afrika in den Sicherheitsrat
Zum Beispiel könnte Indien ständiges Mitglied des Sicherheitsrats werden. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, die drittgrösste Volkswirtschaft und eine Atommacht. Im Jahr 1945 war das riesige Land noch eine britische Kolonie. Es hätte darum auch die Glaubwürdigkeit, den post-kolonialen Globalen Süden im einflussreichsten Gremium der UNO zu vertreten. Die Schweiz könnte also nebst der Stärkung ihres eigenen Handels mit Indien auch die politische Ambition dieses Landes innerhalb der UNO unterstützen. Zudem sollte auch der afrikanische Kontinent mindestens einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat erhalten, den zum Beispiel die Afrikanische Union selbst bestimmen könnte. Angesichts des Überhangs des Globalen Nordens im Sicherheitsrat wäre das mehr als angebracht. Und es wäre zweckmässig, wenn man bedenkt, dass der afrikanische Kontinent Schauplatz der meisten Konflikte und damit Hauptthema des Rats ist. Auch dafür könnte sich eine mutige Schweiz einsetzen.
Zweitens: Steuern für die UNO
Auch eine neue Finanzierung der UNO würde dem Multilateralismus die dringend benötigte politische Kraft verleihen. Die multilateralen Institutionen könnten zum Beispiel mit global erhobenen Steuern auf CO2-Emissionen, auf der internationalen Schiff- und Luftfahrt oder auf transnationalen Finanztransaktionen unabhängig und zuverlässig finanziert werden. Damit würde die UNO weniger abhängig von den Beiträgen der einzelnen Regierungen, was ihre Fähigkeit zur globalen Gouvernanz deutlich stärken würde. Ist die steuerpolitisch meist konservative Schweiz bereit, solche Ideen zu unterstützen?
Drittens: Eine parlamentarische UNO-Versammlung
Eine dritte Reformidee ist die Einrichtung einer parlamentarischen Versammlung der UNO. In der Generalversammlung hat jeder Mitgliedstaat eine Stimme und diese liegt in den Händen der jeweiligen Regierung. Diese erste Kammer könnte durch ein UNO-Parlament als zweite Kammer ergänzt werden. Diese würde die Völker der Welt vertreten, nicht deren Regierungen. Auch diesbezüglich könnte sich die Schweiz am Zukunftsgipfel deutlich verlauten lassen.
Letztlich ist der Zukunftsgipfel von António Guterres vor allem eine Einladung zu einem globalen Brainstorming. Einem gemeinsamen Nachdenken und Diskutieren darüber, wie unsere stark vernetzte und äusserst vulnerable Welt organisiert werden könnte, damit der Frieden und die nachhaltige Entwicklung auch tatsächlich eine Chance erhalten. Die Schweiz sollte in New York nicht nur als Musterschülerin der kleinen Schritte in Erscheinung treten. Sie sollte sich auch mit mutigen Reformideen in die Diskussion werfen.
Dieser Text ist am 20. September 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

Atomfreund Albert Rösti hat es geschafft: Der Gesamtbundesrat will neue Atomkraftwerke (AKW). Trotz klarem Volksentscheid für den Atomausstieg und drei Monate nach dem wuchtigen Ja zum neuen Stromgesetz für erneuerbaren Energien jubelt die AKW-Lobby. Wir – Bevölkerung und Parlament – müssen diesen dreifachen Irrweg stoppen: AKW sind unsicher, bringen nichts für die Versorgungssicherheit und sind ausser für die Atomlobby selber nicht wirtschaftlich.
Erstens gefährden Atomkraftwerke die Sicherheit von uns allen. Das gilt auch für neue, angeblich sicherere AKW. Sie produzieren radioaktiven Abfall, der über 100’000 Jahre hochgefährlich bleibt. Das ist unvorstellbar lang. Wir wissen nicht, wie wir etwas so Gefährliches so lang sicher lagern sollen.
AKW sind ein grosses Terror-Risiko. Im Krieg können Sie zu Atombomben des Feinds im eigenen Land werden. Das wissen wir aus der Ukraine. Und auch das Unfallrisiko ist ungeheuer hoch. Bisher haben rund 200 kommerzielle AKW auf der Welt ihr Lebensende erreicht. 5 Davon, also 2,5 Prozent, hatten in dieser Zeit eine Kernschmelze. Würden Sie Ihre Familie in ein Flugzeug mit 2,5-prozentiger Absturzgefahr schicken?
Zweitens schaffen AKW auch eher weniger statt mehr Versorgungssicherheit. Weil sie unzuverlässig sind. Das haben wir in der Energiekrise von 2022 gesehen. Auslöser war nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch, dass damals die Hälfte – die Hälfte! – der französischen AKW gerade Pannen hatte. Mit Sonne und Wind auf der anderen Seite produzieren wir zwar nicht konstant Strom, aber zuverlässig. Zusammen mit Pumpspeicherwerken, Wasserstoffanlagen und Batterien schaffen wir so eine verlässlichere Stromversorgung als mit AKW.
Neue AKW sind drittens für uns Steuerzahlende ein Fass ohne Boden. Niemand versichert ihre Risiken. Sie bleiben darum zu 100 Prozent bei der Bevölkerung. Und wo in Europa neue AKW gebaut werden, explodieren die Baukosten. Das neue AKW im französischen Flamanville war für 3,4 Milliarden Euro geplant. Kosten wird es 19. Für den Bau im englischen Hinkley Point sieht es ähnlich aus. Finden Sie das eine solide Basis für eine wirtschaftliche Stromversorgung?
Auch in der Energiewirtschaft können wir den Franken nur einmal ausgeben. Was wir für wackelige Atom-Luftschlösser rauswerfen, fehlt für den Aufbau einer nachhaltigen Stromversorgung. Dabei beginnen wir gerade zu sehen, wie viel Investitionen in ein Gesamtsystem mit erneuerbaren Energien bringen. Letztes Jahr haben wir die einheimische Stromproduktion um über 2 Prozent erhöht. Entstanden sind dabei auch Arbeitsplätze in den Alpen und in den Randregionen. Es ist also klar, mit welchem Weg wir eine bessere Zukunft für uns alle schaffen.
Dieser Text ist am 11. September 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Das World Economic Forum ist als Quasi-Zentralorgan des weltweiten Kapitalismus für viele Linke und Grüne ein rotes Tuch. Ebendieses WEF bezeichnet den Biodiversitätsverlust als eine der fünf grössten Gefahren für die nächsten 10 Jahre. Als noch grössere Gefahr als alle Cyber-Risiken inklusive Missbrauch von künstlicher Intelligenz. Sogar das WEF sagt, was die Wissenschaft längst anmahnt: Wir müssen dringend mehr für die Biodiversität tun. Weltweit und in jedem einzelnen Land.
Die Schweiz tut klar zu wenig. Jede dritte Tier- und Pflanzenart und die Hälfte der Lebensräume bei uns sind bedroht. Auf unseren Trockenwiesen konnte man noch vor rund 30 Jahren wunderbare Blumensträusse pflücken. Heute hat es oft nur noch Löwenzahn. Das Bundesamt für Umwelt hat 2021 ermittelt, dass in 75 Prozent der Schweizer Biotope der Biodiversitätsschutz ungenügend ist.
Darum hat der Bundesrat – bekanntlich kein Gremium grüner Fundis – dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative unterbreitet. Dieser Gegenvorschlag hätte immerhin dafür gesorgt, dass schweizweit genügend Schutzfläche in hoher Qualität geschaffen und vernetzt worden wäre, um genug Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Die Schutzfläche wäre von heute 13,4 auf 17 Prozent erhöht und qualitativ ungenügende Schutzgebiete wären saniert worden. Das notwendige Geld hätte man bereitgestellt. Die Mehrheiten im Ständerat und schliesslich auch im Nationalrat lehnten ab.
Kurzsichtige Politik gegen die Natur, die wissenschaftliche Erkenntnisse einfach in den Wind schlägt, verwehrt uns eine gute Zukunft. Wir müssen das Steuer herumreissen. Für den Schutz unserer Biodiversität und damit unserer Lebensgrundlage. Das können wir tun, am 22. September mit einem Ja zur Biodiversitätsinitiative. Tun wir es!
Dieser Artikel ist am 6. September 2024 als Meinungsbeitrag in der Südostschweiz erschienen.

Seit Jahren fordert die Finanzbranche die Senkung des Umwandlungssatzes und damit der Renten in der zweiten Säule. Die Begründung: Die Versicherten würden immer älter, die Renditen sänken, es reiche einfach nicht mehr für die Finanzierung der Renten. Zudem fände eine ungerechtfertigte Umverteilung von den aktiven Jungen zu den pensionierten Alten statt. Diese Argumentation steht am Anfang der BVG-Vorlage, über die wir am 22. September abstimmen. Doch die Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent, welche für Einkommensteile zwischen 22’000 und 88’000 Franken eine Rentensenkung von rund 12 Prozent bewirkt, ist mathematisch schlicht unnötig.
Die Kassen mit Versicherten im überobligatorischen Bereich, also mit Lohneinkommen von über 88’000 Franken, haben ihre nicht regulierten Umwandlungssätze längst gesenkt. Zudem haben die Pensionskassen über 156 Milliarden Franken Reserven gebildet. Und seit der Zinswende im Jahr 2021 gibt es rechnerisch keine Umverteilung mehr von den Jungen zu den Alten, wie die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge des Bundes bestätigt. Seit 2022 finanzieren die Pensionierten kalkulatorisch ihre Altersrente wieder selbst und leisten sogar einen kleinen Beitrag an die aktiven Versicherten. Der Anlass für die Reform ist somit hinfällig.
Es gibt wirklich keinen guten Grund, einer Vorlage zuzustimmen, welche die Pensionskassenrenten ein weiteres Mal senkt und zugleich viel höhere Lohnbeiträge von den Versicherten mit kleinen und mittleren Einkommen verlangt. Mehr bezahlen für weniger Rente – das ist schlicht ein zu schlechter Deal!
Nötig wäre viel mehr eine Reform, welche die Vermögensverwaltungskosten der Pensionskassen senkt. Doch dazu findet man in der Abstimmungsvorlage gar nichts. Der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm berechnet, dass die gesamten Verwaltungskosten der Pensionskassen 8,6 Milliarden Franken betragen. Das sind 1’450 Franken pro versicherte Person und Jahr. Milliarden von Franken landen also bei Versicherungen und Banken, ohne echte Transparenz über deren Tätigkeit.
Effizient geführte Kassen haben gerade einmal halb so hohe Kosten wie der Durchschnitt aller 1’353 Pensionskassen. Deshalb bräuchte es Vorgaben, die Pensionskassen dazu zwingen, standardisierte Kennzahlen zu ihren Verwaltungskosten zu publizieren. So würde Druck für eine effiziente und faire Verwaltung der Sparguthaben entstehen. Die Gewerkschaften schätzen, dass man jährlich bis zu zwei Milliarden Franken zugunsten der Versicherten einsparen könnte. Statt also die Beiträge zu erhöhen und die Renten zu senken, muss das Parlament bei einem neuen Anlauf die Kosten anpacken.
Der einzige Vorteil der aktuellen Vorlage ist die Senkung des Koordinationsabzugs, welche Teilzeit arbeitenden Frauen (und Männern) einen bessere Vorsorge ermöglichen würde. Doch dieser fast unbestrittene Fortschritt wiegt die enormen Nachteile niemals auf. Er kann und soll nach der Ablehnung der Vorlage ins Gesetz aufgenommen werden, ohne zugleich die Renten für alle zu senken.
Dieser Artikel erscheint im Concret, der Zeitschrift der SP Graubünden.

Care poschiavine e cari poschiavini,
charas Svizras e chars Svizzers,
liebe Mitmenschen von nah und fern,
oggi festeggiamo la nostra patria.
Aber für einmal gefällt mir das deutsche Wort besser als das italienische, weil es ohne patriarchale Etymologie auskommt: wir feiern unsere Heimat. «Heimat» vuole dire patria ma anche casa.
A prima vista il concetto è semplice. Ma a un secondo sguardo la questione diventa più complicata se ci chiediamo cosa sia esattamente questa casa comune che chiamiamo anche patria.
Comincio con ciò che è evidente. La nostra casa comune è il pianeta Terra. Che ci piaccia o no, il destino ci ha dato questo pianeta, che a volte ci sembra immensamente grande. Per esempio quando siamo in montagna e realizziamo che dietro a ogni orizzonte c’è una altro orizzonte e poi un altro ancora.
Ogni tanto però il nostro pianeta ci sembra piccolissimo. Per esempio quando lo vediamo su una foto scattata dal telescopio spaziale James Webb. Il pianeta sembra anche piccolo quando ci rendiamo conto di quanto le nostre realtà e le nostre vite siano strettamente connesse con tutto il resto del mondo.
Quanto può essere devastante un piccolo incidente per tutta la popolazione del pianeta l’abbiamo vissuto con la pandemia. Un agente patogeno virale, che salta su un ospite umano in un mercato cinese di cui non conoscevamo l’esistenza, ha letteralmente stravolto la vita di tutte e tutti in tutte le parti del pianeta.
La pandemia, ma anche la sempre più evidente crisi climatica, le congiunture dell’economia globale, le terribili guerre e i conflitti geopolitici: ormai abbiamo capito che facciamo parte di una sola comunità e che abbiamo un destino unico su questo pianeta. Ciò che succede là può avere un impatto e cambiare tutto qua.
Ma voglio correggermi: per la seconda volta mi è sfuggita la parola destino. Non credo nell’immutabilità delle condizioni. Almeno di quelle umane. Abbiamo il potere di cambiarle. Questo è il cuore di ogni convinzione democratica. Quindi meglio dire: la nostra casa è anche la comunità globale.
La risposta alla domanda cosa sia la nostra patria, la nostra casa comune, va ampliata. Essa non va intesa solo geograficamente, ma anche idealmente. Non chiediamoci solo: in quale mondo siamo di casa? Ma piuttosto: in quali valori ci sentiamo a casa?
Con la festa nazionale svizzera non festeggiamo semplicemente il nostro paese come terriorio geografico. Non festeggiamo semplicemente degli eventi storici o una mitologia nazionale. Festeggiamo i nostri valori democratici.
Ma non vogliamo mitologizzare neanche questo. La democrazia che vogliamo e possiamo celebrare qui in Svizzera non è perfetta. Fino a mezzo secolo fa escludeva le donne. E ancora oggi, almeno secondo me, esclude troppe persone che vivono, lavorano e pagano le tasse. Un quarto della nostra popolazione adulta permanente non ha la cittadinanza e quindi non ha ancora voce in capitolo. Questo dal mio punto di vista è un deficit democratico evidente.
Ma l’idea della democrazia, la forza liberatrice della partecipazione, i diritti delle persone, dei cantoni, dei comuni, delle minoranze linguistiche, le nostre libertà fondamentali garantite dalla Convenzione europea per i diritti umani e il nostro stato di diritto indipendente – tutto ciò è un’enorme conquista. Una conquista che unisce tutte e tutti coloro che nel mondo si impegnano per la libertà, per l’autodeterminazione e per i diritti umani.
Se la nostra casa, la nostra patria ideale e valoriale è la democrazia, abbiamo un’ampia patria che si estende oltre i confini del nostro territorio. Ma questa casa, che tutti noi possiamo plasmare insieme come liberi e uguali, è in pericolo.
È in pericolo a causa dei guerrafondai, degli autocrati e dei demagoghi di questo mondo. La guerra contro l’Ucraina e la sua democrazia, la soppressione della democrazia e della libertà in tante parti del mondo, il pericolo di Trump alle porte di Washington, la disinformazione e l’intolleranza presenti in troppi paesi e in troppe comunità sono veramente una minaccia.
Wo die Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit unter Beschuss geraten, erhält die Frage nach der Heimat eine ganz neue, eine brutale Dringlichkeit. Die wunderbare Heimat-Definition von alt Bundesrat Willi Ritschard, wonach Heimat da ist, wo man keine Angst zu haben braucht, wird für zu viele Menschen in Frage gestellt.
Che cosa vuole dire avere paura nella propria casa, nella propria patria ce lo possono raccontare delle nostre concittadine e dei nostri concittadini, i nostri vicini qui nelle nostre vallate, nei nostri paesi di montagna. Per esempio in Mesolcina, in Ticino e in Vallese dove delle persone hanno perso familiari, amici, le loro case, le loro infrastrutture o i loro averi a causa del maltempo a fine giugno e inizio luglio. E qui a Poschiavo vive ancora la memoria dell’alluvione del 1987. Purtroppo con il cambiamento climatico questi rischi naturali aumenteranno. Ma la nostra comunità può affrontarli con solidarietà. Sia nel finanziamento della prevenzione, sia negli aiuti quando succedono le catastrofi. Come fu per Poschiavo 37 anni fa e com’è adesso per i territori toccati.
Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che tra di noi vivono tante persone che hanno dovuto lasciare la loro casa e la loro patria perché non era sicura per motivi politici. Per esempio le donne ucraine fuggite dalle bombe di Putin. O le donne afghane scappate dalla persecuzione dei talebani. O le comunità curde e le persone turche fuggite dalla repressione di Erdogan. E poi ci sono persone per cui è quasi impossibile arrivare in Europa come le donne, gli uomini e i bambini di Gaza, del Sudan, dello Yemen o del Myanmar.
Loro ci ricordano il nostro privilegio di vivere in una patria libera e sicura in cui non bisogna avere paura dei potenti. E ci ricordano le lezioni storiche più importanti. Che anche la pace e la libertà si costruiscono con la cooperazione e con la solidarietà.
Senza solidarità non può esistere una patria degna. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’Europa si è resa conto che singoli stati nazionali o imperi in competizione o addirittura in guerra non sono garanzia di pace, prosperità e progresso per le proprie popolazioni.
Darum hat die europäische Integration den Heimatbegriff vieler Europäerinnen und Europäer erweitert. Und weil diese europäische Einigung eben eine Absage an imperiale Alleingänge und autokratische Gelüste ist, ist sie Diktatoren wie Putin ein so grosser Dorn im Auge.
Lo dico qui a Poschiavo dove è incontestabile che un confine chiuso farebbe crollare il funzionamento dell’economia e della vita pubblica in pochissimo tempo. Voi qui in valle vivete l’Europa integrata della libera circolazione delle persone tutti i giorni. E lo dico sapendo benissimo che è un tema politico caldo e controverso. Da democratico rispetto che una chiara maggioranza delle svizzere e degli svizzeri non voglia aderire all’Unione Europea. Ma so anche che la stragrande maggioranza della nostra popolazione non vuole tornare indietro in un’Europa in cui ci si chiude, ci si disprezza e ci si combatte. È per questo che una maggioranza desidera una Svizzera che pertecipi almeno in certi settori all’integrazione europea tramite i contratti bilaterali.
L’integrazione europea è il risultato della più importante lezione della storia che vale per tutti i popoli: la propria patria può sopravvivere e avere un buon futuro se è compatibile con altre patrie.
Cosa è allora la nostra casa comune, la nostra patria?
La comunità globale, l’idea della democrazia, la solidarietà, l’Europa e naturalmente: la Svizzera!
Questo bellissimo paese muliticulturale, federale, democratico che riesce a far convivere tradizione e innovazione, apertura e protezione, successo e solidarietà, libertà e coesione. Possiamo veramente essere patriote e patrioti, care Svizzere e cari Svizzeri. Non solo il 1° agosto.
Ma dobbiamo fare in modo che il nostro patriottismo non si trasformi mai in nazionalismo. L’orgoglio per le proprie origini non deve mai prendere le sembianze di un’illusione di superiorità. Perchè sappiamo che la nostra casa comune – la nostra «Heimat » – va oltre i confini della Svizzera. Perchè sappiamo che i valori della democrazia, della libertà e della solidarietà sono universali.
Ciò di cui abbiamo bisogno è un amore per la nostra casa comune che unisca le persone invece di metterle l’una contro l’altra. Un patriottismo che guardi al futuro invece che al passato. Che ci spinga a lavorare per una Svizzera migliore per tutte e tutti.
So, nun habe ich in Bezug auf die Heimat vor allem über die grossen ideellen und politischen Zusammenhänge gesprochen. Und ich kann es niemandem verübeln, der sagt: Moment, Heimat ist doch viel intimer. Heimat ist regional, lokal, familiär. Das stimmt. Denn Heimat ist eben vielschichtig. Genauso wie Identität.
Per me i Grigioni sono patria. E non lo dico perchè quest’anno festeggiamo i 500 anni dell’Libero Stato delle Tre Leghe. Sono convinto che appartenere alla Svizzera moderna sia un progresso per il nostro territorio e non voglio romanticizzare il passato indipendente. Per me i Grigioni sono patria per la nostra cultura variegata, le nostre tre lingue, la nostra natura fantastica. Una patria che voglio proteggere e curare. Anche proteggere la nostra natura e il nostro clima è un atto patriottico! Coltivare la nostra cultura e utilizzare e promuovere le nostre lingue sono atti d’amore per la nostra comunità. Come lo sono difendere gli ideali universali dei diritti umani e una Svizzera aperta al mondo.
Ma allora cos’è la patria? Cos’è la nostra casa comune? Was ist Heimat?
Detto in una frase: La nostra casa comune, la nostra patria, è ciò che ne facciamo. Questo è il concetto di una comunità veramente democratica di persone libere e uguali.
Unsere Heimat ist, was wir aus unserer Heimat machen.
Grazie Poschiavo! Per l’invito, per l’attenzione e per la bella festa.
Buon 1° agosto a tutte e tutti!

Wir leben in einer gefährlicher werdenden Welt. Die Klimakrise, der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der islamistische Terror der Hamas und Israels Missachtung des humanitären Völkerrechts im Gazakrieg sowie viele weitere Konflikte und Krisen machen Angst. Dazu kommt, dass Demokratie und Rechtsstaat auf allen Kontinenten von autoritären Kräften angegriffen werden. Xi, Putin, Orban oder Trump lassen grüssen.
Diesen Herausforderungen muss die Schweiz mit einer mutigen Aussenpolitik begegnen. Dem Reflex eines Rückzugs in die vermeintlich sichere Isolation darf nicht nachgegeben werden. Unsere Verfassung verpflichtet uns, internationale Lösungen anzustreben, welche eine regelbasierte Weltordnung überleben lassen. Nur wenn die Stärke des Rechts das Recht des Stärkeren schlägt, kann die Schweiz frei und sicher bleiben.
Darum ist internationale Zusammenarbeit für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung so wichtig. Sie hilft mit, die Welt zu stabilisieren, verhindert weitere Krisen und stärkt die Reputation der Schweiz in der Welt. Der von der SVP und Teilen der FDP geforderte Kahlschlag bei der Entwicklungszusammenarbeit ist deshalb grundfalsch. Er wäre nicht nur eine Bankrotterklärung für die humanitäre Tradition der Schweiz. Er würde fundamentale aussen- und sicherheitspolitische Interessen unseres Landes untergraben.
Im globalen Süden würde die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Dabei liegt dort ein grosses Potenzial für unsere Aussenpolitik. Die Schweiz ist militärisch bündnisfrei und wird gerade im Süden als faire Vermittlerin wahrgenommen. Zudem hat sie keine – zumindest direkte – koloniale Vergangenheit und wird für ihr Bemühen um eine Reform der UNO geschätzt. In vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas oder Asiens hat unser Land ein besseres Image als andere westliche Staaten.
Die Schweiz ist prädestiniert dafür, sich für einen Multilateralismus jenseits starrer Blöcke einzusetzen. Es darf nicht darum gehen, sich autokratischen Regimes anzudienen. Aber gerade das erstarkte aussenpolitische Selbstbewusstsein der Demokratien des Südens wie Indien, Brasilien oder Südafrika erfordert Staaten in Europa, deren aussenpolitisches Denken und Handeln über die Logik der Blockbildung hinausgeht.
Die Schweiz muss sich konsequent und ohne Widersprüche auf die Seite des Völkerrechts schlagen. Im Fall der Ukraine ist dies gelungen. Im Gazakrieg wurde unser Land diesem Anspruch hingegen nicht gerecht. Während die Schweiz am UNO-Hauptsitz in New York zu Recht anmahnte, dass die unter katastrophalen Verhältnissen leidende Zivilbevölkerung geschützt werden müsse und der Zugang zur humanitären Hilfe nicht behindert werden dürfe, verzögerte und kürzte Bundesbern den eigenen Beitrag zu ebendieser Hilfe.
Diese Peinlichkeit wie auch der drohende Kahlschlag bei der Entwicklungszusammenarbeit zeigen, dass aussenpolitische Zusammenhänge in Bundesbern deutlich mehr Beachtung brauchen. Als neuer Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik werde ich mich dafür einsetzen. Weil ich überzeugt bin, dass Isolation und Nabelschau der Schweiz schaden. In einer gefährlicheren Welt können wir uns das schlicht nicht mehr leisten.
Dieser Text ist am 24. Juli 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Die Konferenz vom 15./16. Juni auf dem Bürgenstock zum Frieden in der Ukraine ist ein Erfolg der Schweizer Aussenpolitik. Auf dem Gipfel ging es nicht darum, einen Frieden mit dem Aggressor auszuhandeln. Sondern darum, die Position der Ukraine als Opfer der Aggression zu stärken. Es ist erfreulich, dass dies gelang. 84 der 100 anwesenden Delegationen unterzeichneten eine Schlusserklärung, welche an die Prinzipien der UNO-Charta anknüpfte und somit das Recht auf Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine unterstrich. Damit wies die Konferenz die Welt auf das Offensichtliche hin: Russland will mit seinem Feldzug nicht nur die freie Ukraine vernichten, es zertrümmert auch mutwillig die internationale Rechtsordnung und die europäische Sicherheitsarchitektur.
Gerechter statt Diktat-Frieden
Beim politischen und diplomatischen Widerstand gegen Putin geht es um das Völkerrecht und um Europas Sicherheit. Das zeigt sich auch daran, dass der Kreml seit Jahren versucht, im Baltikum, in Moldau oder in Georgien Grenzen zu verschieben und seinen Einfluss auszuweiten. Auch Russlands Cyberattacken und die Desinformationskampagnen gegen europäische Staaten und Einrichtungen beweisen, dass der Diktator im Kreml unseren Kontinent destabilisieren will.
Dank dem Engagement der Schweiz konnte auf dem Bürgenstock klargestellt werden, wer der Aggressor und wer das Opfer ist. Das ist wichtig. Denn je länger die Aggression dauert, desto mehr werden die Fakten im «Nebel des Krieges» aus Propaganda und Desinformation verwischt.
Ein gerechter Frieden in der Ukraine ist das Ziel aller Staaten guten Willens – nicht aber ein Diktatfrieden des Aggressors. Darum muss die Ukraine dabei unterstützt werden, in eine Position der Stärke zu kommen. Dafür braucht sie von der internationalen Gemeinschaft Hilfe in allen Bereichen: militärisch, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und diplomatisch. Auch die neutrale Schweiz kann und soll mehr tun. Die Aufhebung des Wiederausfuhrverbots von längst verkauftem Kriegsmaterial an die Ukraine durch Partnerstaaten wie Deutschland, Spanien oder Dänemark ist mit dem Neutralitätsrecht vereinbar und sollte vollzogen werden. Ansonsten muss sich die Schweiz aber auf wirtschaftliche, finanzielle, humanitäre und diplomatische Hilfe konzentrieren. Eine konsequente Durchsetzung der Sanktionen, ein Trockenlegen des russischen Rohstoffhandels in der Schweiz, genügend Wiederaufbau- und humanitäre Hilfe sowie weitere diplomatische Initiativen sind entscheidend.
Für mutige Aussenpolitik
Die Schweiz ist Teil einer gefährlicher werdenden Welt. Nicht nur der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine besorgt die Bevölkerung. Auch die Klima- und Biodiversitätskrise, der islamistische Terror, der schreckliche Krieg und die Missachtung des humanitären Völkerrechts in Gaza und viele weitere Konflikte, Krisen und geopolitische Spannungen treiben die Menschen zu Recht um. Dazu kommt, dass die Demokratie als Staatsform des Ausgleichs auf allen Kontinenten von autoritären Kräften angegriffen wird.
All diesen höchst anspruchsvollen Herausforderungen muss eine kluge Aussenpolitik mit Mut begegnen. Dem Reflex eines Rückzugs in die vermeintlich sichere Isolation darf im Interesse der Schweiz nicht nachgegeben werden. Als von der Geografie privilegiertes Land sollten wir zu internationalen Lösungen beitragen, welche die liberale Demokratie und eine regelbasierte Weltordnung überleben lassen.
Es braucht mehr internationale Entwicklungszusammenarbeit, mehr Friedensförderung und mehr internationale Klimapolitik. Es braucht eine moderne Auslegung unserer Neutralitätspolitik, welche die Schweiz als glaubwürdige Anwältin des Völkerrechts positioniert. Und es braucht – endlich! – eine Klärung unserer Beziehung zur Europäischen Union, der besten Nachbarin, die die Schweiz je hatte. Angesichts der angesprochenen globalen Herausforderungen ist es kaum vorstellbar, dass sich die Schweiz gut entwickeln und einen Beitrag zur Lösung der internationalen Probleme leisten kann, wenn sie kein geregeltes Verhältnis zur EU hinkriegt. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Abschluss der laufenden Verhandlungen wird darum das Engagement der Zivilgesellschaft und damit auch unserer SGA-ASPE umso wichtiger.
Wohlstand und globale Verantwortung
Gemäss Zahlen der UNO sind aktuell 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Weltbank beziffert die Anzahl der von extremer Armut betroffenen Menschen auf rund 700 Millionen.
Nach den Berechnungen des Internationalem Währungsfonds hat die Schweiz das vierthöchste Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Welt – nach Luxemburg, Irland und Norwegen. Wenn man als Masseinheit das Vermögen pro Kopf verwendet, ist die Schweiz knapp vor Norwegen sogar das reichste Land überhaupt. Dieser Wohlstand verpflichtet uns zu globaler Verantwortung.
Seit 1970 fordert die UNO, dass die reichen Länder mindestens 0.7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen. Im Jahr 2023 trugen Norwegen 1 Prozent, Luxemburg 0.98 Prozent und Schweden 0.87 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung bei. In der Schweiz waren es lediglich 0.43 Prozent, wenn man die Ausgaben für das Asylwesen abzählt, welche in gewissen Statistiken fälschlicherweise dazugezählt werden. Es ist kein Ruhmesblatt für die reiche Schweiz, wenn neun Staaten gemessen an der Wirtschaftsleistung mehr zur Entwicklung und zum Frieden beitragen als wir.
Die Klassierung könnte sich noch deutlich verschlechtern, wenn sich das unselige Ansinnen durchsetzt, die massive Aufrüstung der Armee müsse durch drastische Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit gegenfinanziert werden. Dieser Kahlschlag auf dem Buckel der Ärmsten würde langjährig aufgebaute Strukturen der erfolgreichen Schweizer Entwicklungspolitik zerstören. Und auch multilaterale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das Menschen vor dem Hungertod bewahrt, oder das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF könnten von der Schweiz nicht mehr genügend unterstützt werden. Eine moralische Bankrotterklärung für die humanitäre Tradition und ein schwerer Schaden für das Ansehen der Schweiz in der Welt.
Multilateralismus statt Blockbildung
Gerade im globalen Süden würde die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie sich aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit weitgehend zurückziehen würde. Dabei liegt dort ein grosses Potential für unsere Aussenpolitik. Immerhin ist unser Land Depositarstaat der Genfer Konventionen und zweitwichtigster UNO-Standort. Die Schweiz ist militärisch bündnisfrei und wird in vielen Teilen der Welt als faire Vermittlerin wahrgenommen. Zudem hat die Eidgenossenschaft keine (zumindest direkte) koloniale Vergangenheit und wird innerhalb der multilateralen Institutionen für das ehrliche Bemühen um eine Reform der UNO geschätzt. In vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas oder Asiens hat die Schweiz aus den genannten Gründen ein positiveres Image als viele anderen europäische oder westliche Staaten.
Darum ist unser Land geradezu prädestiniert dafür, die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden zu fördern und sich im Interesse des Völkerrechts für einen Multilateralismus jenseits starrer Blöcke einzusetzen. Es kann natürlich nicht darum gehen, sich autokratischen Regimes anzudienen. Aber gerade das erstarkte aussenpolitische Selbstbewusstseins der Demokratien des Südens wie Indien, Brasilien oder Südafrika erfordert Staaten in Europa, deren aussenpolitisches Denken und Handeln über die Logik der Blockbildung hinausgeht.
Anwältin des Völkerrechts
Die Schweiz braucht den Mut, sich konsequent und in allen Situationen auf die Seite der internationalen Rechtsordnung zu schlagen. Auch dann, wenn es etwas kostet oder wenn befreundete Staaten andere Prioritäten verfolgen. Will die Schweiz als Anwältin des Völkerrechts glaubwürdig sein, darf es diesbezüglich keine Doppelstandards und keine Widersprüche geben. Im Gaza-Krieg ist unser Land daran gescheitert. Während die Schweiz am UNO-Hauptsitz in New York zu Recht forderte, dass die unter katastrophalen Verhältnissen leidende Zivilbevölkerung geschützt werden müsse und der Zugang zur humanitären Hilfe nicht behindert werden dürfe, verzögerte und kürzte Bundesbern den eigenen Beitrag zu ebendieser Hilfe.
Im Fall der Bürgenstock-Konferenz für die Ukraine hat der Bundesrat hingegen Mut bewiesen. Wird er diesen auch bei den übrigen aussenpolitischen Herausforderungen finden? Wird er sich im finanzpolitischen Verteilkampf schützend vor die Entwicklungszusammenarbeit stellen? Ist er bereit, sich voll für ein gutes Verhandlungsergebnis mit der EU inklusive einer starken flankierenden Gesetzgebung in den heiklen Bereichen Lohnschutz, Strom und Bahnverkehr einzusetzen? Wird er im Abstimmungskampf gegen die reaktionäre Neutralitätsinitiative engagiert ein modernes Neutralitätsverständnis der Schweiz als Anwältin des Völkerrechts verteidigen?
Die SGA-ASPE wird all diese Herausforderungen der Schweizer Aussenpolitik aktiv begleiten. Wir betreiben keine Propaganda, aber wir haben immer eine Haltung: Für eine aussenpolitisch engagierte Schweiz.
Dieser Text ist am 28. Juni 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

300 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sie brauchen Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Hilfe oder physischen Schutz. Kriege, Naturkatastrophen oder Hunger bedrohen ihre Existenz unmittelbar. Humanitäre Hilfe sichert ihr Überleben, während Entwicklungszusammenarbeit einen wichtigen Beitrag leistet, damit diese und andere Menschen dauerhaft der Armut entkommen. Die Weltbank beziffert die Anzahl der von extremer Armut betroffenen Menschen auf 647 Millionen.
Gemäss Internationalem Währungsfonds hat die Schweiz das vierthöchste Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Welt – nach Luxemburg, Irland und Norwegen. Wenn man als Masseinheit das Vermögen pro Kopf verwendet, ist die Schweiz knapp vor Norwegen sogar das reichste Land überhaupt.
Seit 1970 fordert die UNO, dass die wohlhabenden Länder mindestens 0.7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen. Im Jahr 2023 trugen Norwegen 1 Prozent, Luxemburg 0.98 Prozent und Schweden 0.87 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung bei. In der Schweiz waren es lediglich 0.43 Prozent. Es ist kein Ruhmesblatt für die superreiche Schweiz, wenn neun Staaten gemessen an der Wirtschaftsleistung mehr zur Entwicklung und zum Frieden beitragen als wir. Aber mit 0.43 Prozent gehören wir immerhin noch zu den Top Ten.
Diese Klassierung wird sich allerdings drastisch verschlechtern, sollte sich der Ständerat mit seinen Beschlüssen durchsetzen. Die kleine Kammer hat am Montag ein weiteres Mal beschlossen, die Armeeausgaben stark aufzustocken, um vier Milliarden Franken bis 2030. Um die zusätzliche Aufrüstung zu finanzieren, will der Ständerat aber nicht etwa die starre Schuldenbremse aufweichen oder zusätzliche Einnahmen finden. Nein, er will andere Aufgaben des Bundes zusammenstreichen. Zwei Milliarden, also die Hälfte des Betrags, bei der Entwicklungszusammenarbeit. Das sind 500 Millionen pro Jahr.
Das ist ein Kahlschlag auf dem Buckel der Ärmsten dieser Welt. Die drastischen Kürzungen stoppen laufende Projekte und zerstören jahrzehntelang aufgebaute Strukturen der erfolgreichen Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. 500 Millionen Franken pro Jahr ist übrigens mehr Geld, als die gesamte Unterstützung der Schweiz für Afrika. Setzt sich der Ständerat durch, lässt die Schweiz die Bevölkerung ganzer Länder im Stich. Auch multilaterale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das Menschen vor dem Hungertod bewahrt, oder das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF würden von der Schweiz nicht mehr genügend unterstützt. Die Auswirkungen für die betroffenen Menschen aber auch für das internationale Ansehen der Schweiz wären verheerend.
Der Ständerat versteht sich gerne als «chambre de réflexion». Für die internationale Zusammenarbeit wurde er diese Woche zur «chambre de destruction», wie die Organisation Alliance Sud treffend festhält. Es ist am Nationalrat, diesen kolossalen Fehlentscheid zu korrigieren. Ein reiches Land wie die Schweiz, das sich dem Frieden, den Menschenrechten und einer humanitären Tradition verpflichtet fühlt, darf sich angesichts der Krisen und Kriege auf der Welt nicht aus seiner globalen Verantwortung stehlen.
Dieser Text ist am 5. Juni 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

«Let’s drink to the hard working people, let’s drink to the salt of the earth», singt Mick Jagger in der legendären Working-Class-Hymne der Rolling Stones. Als agnostischer Mensch habe ich Hemmungen vor Bibelzitaten. Und doch finde ich: Jagger und die Stones haben Recht.
Die hart arbeitenden Menschen schaffen die Werte unserer Wirtschaft. Sie sorgen für Fortschritt und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Durch sie entsteht Würde für und Zugehörigkeit unter Menschen.
Die Bähnlerinnen und Chauffeure, die Kindergärtner und Lehrerinnen, die Verkäuferinnen und Lageristen, die Elektroinstallateure und Polizistinnen, die Pflegerinnen und Bauarbeiter, die Sozialarbeiter und die Sanitärinnen, die Köche und die Apothekerinnen, die Sekretärinnen und die Strassenkehrer – sie alle und viele mehr sind es, die jeden Tag dafür sorgen, dass unser Leben funktioniert. Mit ihrer Erwerbsarbeit einerseits und mit ihrer unbezahlten Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit andererseits. Sie sind tatsächlich das Salz der Erde!
Deshalb feiern wir sie und ihre Arbeit jedes Jahr am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Und in den übrigen 364 Tagen des Jahres engagieren wir uns dafür, dass die Arbeit endlich den Respekt und die Anerkennung erhält, die sie verdient.
Für den sozialen Fortschritt im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik.
In der Schweiz haben wir die Chance, diesen sozialen Fortschritt über Volksabstimmungen voranzutreiben. Am 3. März haben wir es dieses Jahr ein erstes Mal geschafft. Nach Jahren des Niedergangs der Pensionskassenrenten und immer höheren Kosten für die Bevölkerung bei den Mieten, den Prämien und der Energie – einem erheblichen Kaufkraftverlust – hat auch die Schweiz eine 13. Monatsrente eingeführt.
Ab 2026 wird 13. AHV-Rente dafür sorgen, dass die Kaufkraftverluste der letzten Jahre für alle dannzumaligen und künftigen Rentnerinnen und Rentner ausgeglichen werden.
Obwohl monatelang behauptet wurde, die 13. AHV-Rente sei unmöglich und egoistisch und würde die jüngere Generation massiv belasten, liessen sich die Schweizerinnen und Schweizer nicht ist Bockshorn jagen.
Weil der Generationenkonflikt aber weiterhin herbeigeredet wird, will ich heute am Tag der Arbeit eines klarstellen:
Historisch hat nichts das Verhältnis zwischen den Generationen mehr verbessert als die AHV. Sie hat auf der einen Seite der breiten Bevölkerung ein Alter in Würde ermöglicht. Und sie hat auf der anderen Seite die Jungen von der Bürde entlastet, auch finanziell für ihre Eltern sorgen zu müssen. Für jüngere Generationen war und ist die AHV die wohl grösste finanzielle Entlastungsmassnahme aller Zeiten. Diese AHV als Last für die Jungen zu verleumden, ist absurd. Denn bei der AHV erhalten statistisch neun von zehn Personen mehr Rente zwischen der Pensionierung und dem Lebensende, als sie im gesamten aktiven Arbeitsleben einbezahlt haben. Darum ist auch eine 13. AHV-Rente sicher keine Last für die Jungen sondern ein Stück Gerechtigkeit für Jung und Alt.
Am 9. Juni haben wir die nächste Chance, den sozialen Fortschritt voranzutreiben und etwas für die Kaufkraft der Menschen zu tun. Dann stimmen wir über die Prämien-Initiative ab. Sie ist dringend nötig, denn die Krankenkassenprämien explodieren. Das bringt immer mehr Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Mit einem Ja am 9. Juni stoppen wir die jährliche Zumutung des Prämienanstiegs für Familien, Rentnerpaare, Alleinstehende mit tiefen und mittleren Einkommen.
Denn mit der Initiative würden die Prämien gedeckelt und dürften neu nicht mehr als zehn Prozent des verfügbaren Einkommens eines Haushalts ausmachen. Damit schützen wir insbesondere die hart arbeitende Mittelschicht vor der einzigen, jährlich steigenden Steuer in unserem Land. Und erst noch der unsozialsten – einer Kopfprämie! Erstaunlich, dass ausgerechnet diejenigen, die sonst immer behaupten, die «Steuerbelastung des Mittelstandes» senken zu wollen, bei der für die Mittelschicht schlimmsten, jährlich steigenden Steuer gegen Entlastung sind.
Sie ziehen auch in diesem Abstimmungskampf durch das Land und machen den Menschen Angst. Wir könnten uns den Prämiendeckel nicht leisten, die Kosten seien zu hoch. Das ist Quatsch. Die Prämien-Initiative verursacht keinen einzigen Rappen Mehrkosten. Sie sorgt einfach dafür, dass die bestehenden und künftigen Kosten ein wenig gerechter verteilt werden.
Statt dass die Kosten unserer Gesundheitsversicherung voll bei der Mittelschicht und bei den Familien bleiben, sorgen wir mit einem Ja zur Prämien-Initiative dafür, dass jeder Franken über der Schwelle von 10% des jeweiligen Haushaltseinkommens durch die Allgemeinheit und damit sozial finanziert wird.
Die Frage ist einfach: Wollen wir, dass alle künftigen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen einfach über Prämienerhöhungen von der hart arbeitenden Mittelschicht getragen werden? Oder soll der Staat, der dank den progressiven Steuern viel stärker von den Reichen und Superreichen finanziert wird, seinen korrekten Beitrag leistet?
Die zweite Option ist ein offensichtliches Gebot der Gerechtigkeit. In keinem Land Europas müssen die Menschen mehr aus der eigenen Tasche für die Gesundheitskosten zahlen als in der Schweiz. Wegen unseren Kopfprämien, wegen unseren im Schnitt hohen Franchisen und wegen der Tatsache, dass einige Leistungen wie die Zahnmedizin durch die obligatorische Krankenversicherung nicht gedeckt sind.
Im europäischen Schnitt werden 76% der Gesundheitskosten über einkommensabhängige Steuern oder Lohnbeiträge finanziert. In der Schweiz sind wir bei läppischen 36%. Die Prämien-Initiative würde dieses schiefe Verhältnis moderat verbessern.
Die Prämien-Initiative ist also wirklich keine Revolution, sie ist eine soziale Notwendigkeit. Wir alle müssen uns für ein Ja am 9. Juni engagieren!
Nun wenden unsere Gegner ein, dass der soziale Fortschritt einer 13. AHV-Rente und des dringend notwendigen Prämiendeckels die Staatskassen mehr belasten, was angesichts der «angespannten Finanzlage» unverantwortlich sei. Auch dieses Argument ist falsch. Die Staatfinanzen in der Schweiz sind nicht angespannt. Im Gegenteil. Fast alle Kantone schreiben Gewinne. Und sowohl der Bund als auch die meisten Kantone haben einen so tiefen Schuldenstand, dass keine vernünftige Ökonomin darauf kommen würde, die Schweiz sei ein Fall für Sparmassnahmen. Das einzige Finanzprobleme, welches unser Land tatsächlich hat, ist der Schuldenbremsenfetischismus der rechten Parteien.
Als Bund haben wir eine Nettoverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung von 17.8%, das ist lächerlich tief. Wir könnten diese Schuld auf einen Schlag verdoppeln und hätten bei allen Ratingagenturen immer noch die Bestnote AAA. Die fiskalisch sehr konservativen Ökonominnen und Ökonomen, welche die Maastrichter Kriterien ausgearbeitet haben, definieren eine Schuldenquote von bis zu 60% als gesund – und wir haben nicht einmal 18%!
Natürlich sind Schulden nicht per se anstrebenswert und es wäre klüger, zusätzliche Aufwendungen des Staates mit klugen Steuern auf dem Kapital, auf grossen Erbschaften oder auf Finanztransaktionen zu finanzieren. Aber ein reales Finanzproblem haben wir auch ohne diese sinnvollen Steuern definitiv nicht. Wir haben ein rein ideologisches Problem bei der rechten Mehrheit im Bundesrat und im Parlament.
Am 9. Juni stimmen wir auch über das Stromgesetz ab. Auch diese Abstimmung ist wichtig für eine soziale Schweiz. Denn ein Ja zum Stromgesetz ist notwendig, um unsere Klimaziele erreichen. Und Klimaschutz ist auch eine soziale Notwendigkeit. Weil wir wissen, dass es in einer kaputten Natur keine gute Arbeit und keine soziale Gerechtigkeit geben kann. Ausserdem wissen wir, dass nur eine sichere Energieversorgung mit erneuerbarem Strom stabile und bezahlbare Energiepreise in Zukunft sichern kann. Die drei grössten Kaufkraftkiller sind die Mieten, die Prämien und eben die Energiekosten. Damit wir in Zukunft die Energiekosten für die Bevölkerung unter Kontrolle behalten, müssen wir im grossen Stil erneuerbare Energien zubauen. Auch das schaffen wir mit einem Ja zum Stromgesetz am 9. Juni.
Für dauerhaften sozialen Fortschritt braucht es aber nicht nur punktuelle Erfolge bei Abstimmungen. Die Herausforderung ist grösser. Es braucht ein kollektives Bewusstsein dafür, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse keine Naturereignisse sind, sondern das Resultat von politischen Entscheidungen. Es ist zum Beispiel nicht einfach Schicksal, dass in der wohlhabenden Schweiz zugleich gegen 900’000 Menschen in Armut leben, während die 300 Reichsten ein Vermögen von gegen 900 Milliarden – mehr als das Zehnfache des Bundesbudgets – besitzen.
Diese ungeheure Ungleichheit ist das Resultat einer unsozialen Politik. Und deshalb kann sie auch überwunden werden. Aber wir müssen uns dafür engagieren: politisch, gewerkschaftlich, im Alltag. Damit mehr Menschen erkennen, dass sie Teil einer solidarischen Veränderung sein können. Das ist letztlich die Idee der sozialen Demokratie, für die der Tag der Arbeit steht.
Wie ihr wisst, ist der 1. Mai der einzig wirklich globale Feiertag. Denn der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter um Würde, Freiheit und Gerechtigkeit war und ist ein weltweiter.
Darum schliesse ich mit einigen Gedanken an unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter in anderen Teilen der Welt.
Ich möchte an die Aktivistinnen und Aktivisten erinnern, die in gefährlichen und unfreien Teilen der Welt ihr Leben riskieren, um sich für Freiheit, sozialen Fortschritt, Gerechtigkeit, Frieden und Menschenrechte einzusetzen. Vor einem Monat durfte ich mit dem Hilfswerk Swissaid und sechs Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat Kolumbien bereisen. Obwohl das Land in Europa mittlerweile als «Post-Conflict» und «Middle-Income Country» gilt, ist die Ungleichheit und damit auch die Armut riesig und es sterben immer noch täglich viele Menschen an der Gewalt von bewaffneten Gruppen. Aber die lebendige Zivilgesellschaft leistet Widerstand gegen die Gewalt. Diese lebendige Zivilgesellschaft engagiert sich für einen dauerhaften Frieden, der auf sozialer Gerechtigkeit gebaut wird.
Wir haben die 26-jährige indigene Yina Ortega Benitez kennengelernt, die als Jugendliche ihr Heimatdorf verlassen musste, weil ihr dort die Zwangsprostitution oder die Zwangsrekrutierung durch eine bewaffnete Gruppe gedroht hätte. Dank Swissaid konnte sie studieren und hat heute eine gute Arbeit.
Yina ist zudem Jugendaktivistin und Jungpolitikerin, in der Schweiz wäre sie wohl in der JUSO. Während hiesige Jusos relativ unbeschwert politisieren können, muss sich Yina immer wieder verstecken, weil ihr Leben bedroht wird. Die bewaffneten Gruppen wollen nicht, dass sie den Jugendlichen hilft, sich aus den Fängen der Gewaltkultur und der bewaffneten Gruppen zu lösen.
Obwohl sie alles riskiert, ist Aufgeben für die junge Frau keine Option. Sie will mit ihren Freundinnen und Freunden weiter für den Frieden und für die sozialen Rechte der Jugend kämpfen. Dabei hat ihre Organisation eine klare Vorstellung für ihre Friedensarbeit. Sie schreiben einen wunderbaren Satz:
«Frieden ist nicht die Abwesenheit von bewaffnetem Konflikt – Frieden herrscht erst, wenn die Menschen wieder ein Recht auf Bildung, auf gute Arbeit, auf Sicherheit und Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit haben.»
Unsere Gedanken sind heute bei allen Yinas dieser Welt. Und auch bei allen unschuldigen Menschen, die an den schrecklichen Kriegen und Konflikten leiden: In der Ukraine, in Gaza, im Yemen, im Sudan, in Myanmar aber auch in allen übrigen rund 90 bewaffneten Konflikten, die wir nicht täglich auf dem Radar haben.
Freiheit, Frieden, sozialer Fortschritt, Gerechtigkeit und Menschenrechte. Letztlich sind das die Werte, die den 1. Mai überall auf der Welt ausmachen. Diese Werte stellen die Hoffnung für eine bessere Zukunft dar. Sie fallen aber nicht vom Himmel. Wir müssen uns für diese Werte engagieren. Am Tag der Arbeit und an jedem anderen Tag. Tun wir es mit Freude, tun wir es zusammen.
Es lebe der 1. Mai – hoch die internationale Solidarität!
Anfangs April durfte ich mit sechs Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat an einer Informationsreise des Hilfswerks Swissaid in Kolumbien teilnehmen. Swissaid und die Schweiz unterstützen den kolumbianischen Friedensprozess, die sogenannte «Paz Total».

Vom 1. bis zum 6. April bereiste unsere Delegation die kolumbianische Hauptstadt Bogotá und das sehr arme Departement Sucre an der Karibikküste. Die Delegation wurde von Swissaid-Co-Präsident und Nationalrat Fabian Molina (SP) geleitet. Es gehörten ihr die Nationalrätinnen und Nationalräte Corina Gredig (GLP), Marc Jost (EVP), Martina Munz (SP), Pierre-André Page (SVP), Benjamin Roduit (Mitte) und meine Person an. Organisiert wurde die Reise vom äusserst kompetenten kolumbianischen Swissaid-Team, das uns genauso wie Swissaid-Geschäftsführer Markus Allemann, Mediensprecherin Thaïs In der Smitten und Geschäftsleiter von Alliance Sud, Andreas Missbach, begleitete. Für die Kosten der Reise kam jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer selbst auf.

Land der Gegensätze
Kolumbien ist ein Land der krassen wirtschaftlichen und sozialen Gegensätze. Einerseits erlebten wir in Bogotá einen grossen Wohlstand und eine friedliche Stimmung, von der Gewalt der Vergangenheit findet sich zumindest im Zentrum keine Spur. Wir trafen viele engagierte, hoch qualifizierte Menschen, die mit einem beeindruckenden Optimismus daran arbeiten, ihr Land voranzubringen. Die Fortschritte sind offenkundig, was auch von niemandem infrage gestellt wird.
Andererseits gibt es in ländlichen Regionen immer noch sehr viele Menschen, die auf direkte humanitäre Hilfe angewiesen sind. Im Gespräch mit dem IKRK-Chef in Kolumbien, Lorenzo Caraffi, lernten wir, dass die Gewalt in einigen ländlichen Regionen wieder zunimmt. Die Wahrnehmung in Europa, wonach Kolumbien mittlerweile ein «Post-Conflict» und ein «Middle-Income Country» sei, stimme zwar für die Hauptstadtregion und für andere entwickelte Gebiete, aber nicht für ganz Kolumbien. Die Armut eines grossen Teils der Landbevölkerung wurde für uns sichtbar, als wir die Projekte von Swissaid im Departement Sucre besuchten. Dort erfuhren wir auch von der Gewalt als alltägliche Realität. In der Kleinstadt Morroa mit ihren rund 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es statistisch jeden Tag einen Mord.
Der steinige Weg zum Frieden
Dabei gab und gibt es viel Hoffnung. 2016 schloss die kolumbianische Regierung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos ein umfassendes Friedensabkommen mit der grössten Guerilla-Organisation FARC ab. Das war und ist ein historischer Durchbruch, hatte dieser Konflikt doch 52 Jahre gedauert und Hunderttausende Menschenleben gekostet. Die FARC legte mit dem Abkommen die Waffen nieder und wandelte sich in eine legale politische Partei um. Nicht umsonst erhielt Präsident Santos dafür den Friedensnobelpreis. Leider gelang es der Nachfolgeregierung von Präsident Iván Duque nicht, der verarmten ländlichen Bevölkerung in den ehemaligen FARC-Gebieten eine Perspektive zu bieten. Dies lag wohl am fehlenden Willen, war doch Präsident Duque ein erklärter Gegner des Friedensabkommens. Wegen der friedenspolitischen Untätigkeit seiner Regierung traten anstelle der FARC andere Guerilla-, paramilitärische oder schlicht kriminelle Gruppen, welche Teile des Landes bis heute kontrollieren und unsicher machen.
Seit 2022 ist die Regierung von Präsident Gustavo Petro im Amt – die erste links-progressive Regierung in der Geschichte Kolumbiens. Ihre Priorität liegt auf der nachhaltigen Lösung aller anhaltenden Konflikte im Rahmen einer umfassenden Friedenspolitik, der «Paz Total». Diese Politik will das Friedensabkommen von 2016 vollständig umsetzen, was auch eine Landreform und damit Gerechtigkeit für die ländliche Bevölkerung bedeuten würde. Zudem will die Regierung mit allen noch bestehenden bewaffneten Gruppen einen Frieden aushandeln und dank Strukturreformen in der Drogen-, Sozial-, Umwelt- und Sicherheitspolitik die Lebensbedingungen der Menschen so verbessern, dass es keinen Nährboden für die Gewalt gibt. Ob all die hochgesteckten Ziele erreicht werden, ist zweifelhaft. Die den Grossgrundbesitzenden nahestehende Opposition hat eine Mehrheit im Kongress und nicht alle Mitglieder und Beamten der Regierung Petro bringen die nötigen Erfahrungen und Kompetenzen mit. Nach zwei Jahren im Amt leidet die Regierung an einem Popularitätstief. Trotzdem ist unbestritten, dass sie neue Akzente für Kolumbien setzt.
Der Schweizer Botschafter Eric Mayoraz und sein Team engagieren sich im Namen der Schweiz für die Unterstützung des kolumbianischen Friedensprozesses. Ausgestattet mit einem offiziellen Mandat der Verhandlungsparteien fördert die Schweiz die Friedensgespräche der Regierung mit verschiedenen Guerillagruppen als Garanten- und als Begleitstaat. Nebst dieser Rolle als Vermittlerin engagiert sich die Schweiz auch mit Projekten zur politischen Mitwirkung der Bevölkerung und zur Versöhnungsarbeit. Dass dieses Engagement der Schweiz sehr geschätzt wird, konnten wir an einem Treffen mit dem Aussenminister Kolumbiens erfahren. Minister Luis Gilberto Murillo betonte, wie wichtig es sei, dass sich die Schweiz als Mitglied im UN-Sicherheitsrat so stark für den Frieden in Kolumbien engagiere. Damit übernehme unser Land eine Art Scharnierfunktion zwischen dem UN-Sicherheitsrat und den Friedensverhandlungen vor Ort. Dafür sei Kolumbien sehr dankbar.

Bauern ohne Landrecht
Über schwer befahrbare Naturstrassen gelangte unsere Delegation zu den Bauern Arcelio und Jorge Monterroza. In der drückenden Hitze des tropischen Trockenwalds im Departement Sucre bestellen sie seit Jahrzehnten ein Land, das ihnen zwar faktisch, aber nicht formell gehört. Sie haben schlicht keine verbrieften Rechte dafür. Dies verunmöglicht ihnen den Zugang zu staatlicher Unterstützung und belässt sie in einer frustrierenden Rechtsunsicherheit. Die Mehrheit der Kleinbauern Kolumbiens hat das gleiche Problem. Und die Prozeduren, um die Landrechte verbriefen zu lassen, sind extrem langwierig, obwohl eine gerechte Verteilung des Landes eigentlich erklärtes Ziel der Regierung ist.
Swissaid unterstützt diese und viele andere Kleinbauern bei ihren administrativen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Indem sie im biologischen Landbau angeleitet werden, können sie ihre Familien trotz des Klimawandels sicher ernähren und machen ihre Böden widerstandsfähiger. Tatsächlich ist die Vegetation auf dem Boden der Monterrozas vielfältiger als auf dem Land des Nachbars, der sich nicht am agroökologischen Projekt von Swiss-aid beteiligt, wie die herzlichen Bauern stolz anmerkten.

Engagierte Jugend
In der Stadt Sincelejo im Departement Sucre machte unsere Delegation Bekanntschaft mit Aktivistinnen und Aktivisten der Jugendplattform «Agenda Caribe. Paz con Juventud» (Karibische Agenda. Frieden mit der Jugend). Mit Unterstützung von Swissaid setzen sie sich im Rahmen der «Paz Total» für die Rechte der Jugendlichen, für Bildung und für Teilhabe ein – und riskieren dabei ihr Leben.
Die 26-jährige indigene Yina Ortega Benitez hat als Jugendliche ihr Heimatdorf verlassen, weil ihr dort die Zwangsprostitution oder die Zwangsrekrutierung durch eine bewaffnete Gruppe gedroht hätte. Dank Swissaid konnte sie studieren und arbeitet heute als Sozialarbeiterin. Yina wurde sogar als Gemeinderätin von Palmito gewählt und stand zeitweise unter Polizeischutz oder versteckte sich im Bedrohungsfall bei Freunden. Doch Aufgeben ist für die junge Frau keine Option, sie will mit ihren Freundinnen und Freunden weiter für den Frieden und für die Rechte der Jugend kämpfen. Dabei hat die Plattform eine klare Vorstellung für ihre Aufklärungs- und Organisationsarbeit: «Frieden ist nicht die Abwesenheit von bewaffnetem Konflikt – Frieden herrscht erst, wenn die Menschen wieder ein Recht auf Bildung, Sicherheit und Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit haben.»

Mehr, nicht weniger Zusammenarbeit
Vom gewieften Aussenminister Luis Gilberto Murillo über die zähen Kleinbauern Arcelio und Jorge Monterroza bis zur inspirierenden Jugendaktivistin Yina Ortega Benitez – diese Begegnungen und viele mehr haben alle Mitglieder unserer Delegation schwer beeindruckt. Natürlich stehen noch riesige politische und wirtschaftliche Hindernisse auf dem Weg Kolumbiens zur «Paz Total». Aber die lebendige kolumbianische Zivilgesellschaft mit ihren fantastischen Menschen ist eine enorme Ressource und Hoffnungsträgerin für dieses Unterfangen.
Die Schweiz leistet einen wichtigen Beitrag zum Frieden und hat einen ausgezeichneten Ruf in Kolumbien. Dazu trägt mit Sicherheit auch die wertvolle Arbeit von Swissaid bei, die ganz konkrete Perspektiven für die Kleinbauern schafft und den Aufbau der so wichtigen gesellschaftlichen Netzwerke gegen Gewalt und für die Rechte der Frauen und der Jugend ermöglicht.
Diese Reise bestätigt meine Überzeugung, dass eine engagierte Schweizer Aussenpolitik mit Schwerpunkten bei der Friedensförderung und der nachhaltigen Entwicklung wirklich einen Unterschied macht – und im Interesse unseres Landes liegt. Umso unverständlicher ist es, dass sich der Bundesrat bei der Entwicklungszusammenarbeit aus Südamerika verabschieden und allgemein in diesem Bereich massiv sparen will. Wir brauchen in einer gefährlicher werdenden Welt mehr, nicht weniger internationale Zusammenarbeit. Die Schweiz kann und muss sich das leisten.
Dieser Text ist am 29. April 2024 als Gastbeitrag im „Bündner Tagblatt“ erschienen.

Andreas Zünd ist der Schweizer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Manche verunglimpfen Herrn Zünd gerade als Landesverräter. Grund ist, dass er seinen Job als unabhängigen Richter gemacht hat.
Zusammen mit den anderen Richterinnen und Richtern hat Herr Zünd befunden, dass die Schweiz gegen die Menschenrechte ihrer eigenen Bevölkerung handelt, weil sie nicht genug gegen den Klimawandel tut. Dem Urteil vorausgegangen war eine Klage der Schweizer Klimaseniorinnen, dass die Schweiz mit der halbherzigen Umsetzung ihrer Klimapolitik die körperliche Unversehrtheit und damit das Recht auf ein Privatleben der Schweizerinnen und Schweizer zu wenig schützt.
Ein Richter muss unabhängig und im Sinn des Gesetzes handeln. Er darf kein Befehlsempfänger einer Regierung sein, auch nicht seiner eigenen. Und das Gesetz, das Herr Zünd anwenden muss bei seinen Urteilen, sind die Menschenrechte. Einer der wichtigsten Grundpfeiler der modernen Zivilisation.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist ein ermutigendes Zeichen für eine unabhängige Justiz. Wer nicht vorsätzlich die Augen verschliesst, weiss, dass wir bis jetzt zu wenig getan haben gegen den Klimawandel. Alle, die das Pariser Klimaabkommen und das vom Volk angenommene Schweizer Klimaschutzgesetz kennen, haben es Schwarz auf Weiss. Und die Klimawissenschaft ist sich sowieso einig, dass wir mehr tun müssen, wenn wir nicht dramatische Konsequenzen für das Wohlergehen von Millionen von Menschen riskieren wollen.
Die Richterinnen und Richter haben daher Recht, wenn sie Klimaschutz als Voraussetzung für die Umsetzung der Menschenrechte bezeichnen. Und nein, sie haben sich auch nicht in die Schweizer Innenpolitik eingemischt. Sie sagen mit keinem Wort, welche Massnahmen die Schweizer Politik ergreifen muss. Sie sagen nur: Wir müssen die Klimaziele ernsthaft verfolgen. Für unsere Menschenrechte.
Damit erinnern die Richterinnen und Richter den Bundesrat und das Parlament an ihre Pflicht, völkerrechtliche Verträge und schweizerische Gesetze zu respektieren. Genau das zu tun, ist eine klassische Aufgabe einer unabhängigen Justiz.
Für die 46 Mitgliedsstaaten des Europarates ist das Urteil gegen die Schweiz ein Leiturteil. Alle Staaten Europas müssen nun den menschengemachten Klimawandel im Interesse der Gesundheit und des Lebens – und damit auch der Menschenrechte – ihrer Bevölkerung besser bekämpfen.
Dass die SVP wegen des Urteils gleich aus dem Europarat austreten will, erstaunt nicht. Sie hat in den letzten Jahrzehnten weder die Menschenrechte noch den Klimawandel je besonders ernst genommen.
Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wissen aber zum Glück, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zum Schutz ihrer Rechte da ist. Sie haben 2018 die SVP-Initiative gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und ihren Gerichtshof haushoch abgelehnt.
Sie wissen auch: Wenn die Schweiz, Europa und die Welt scheitern beim Bekämpfen des Klimawandels, hat das dramatische Folgen für die Menschenrechte von uns allen. Wir in der Berner Politik sollten das Urteil als Chance für mehr Klimaschutz nutzen, statt darüber zu jammern, dass es in Strassburg und nicht irgendwo in der Schweiz gesprochen worden ist.
Dieser Text ist am 17. April 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Plakatwände, Inserate, Instagram-Posts und die meisten Medienkommentare behaupten, dass eine 13. AHV-Rente die jüngere Generation belasten wird. Dieses Narrativ ist geschichtsvergessen und falsch.
Historisch hat nichts das Verhältnis zwischen den Generationen mehr verbessert als die AHV. Sie hat der breiten Bevölkerung ein Alter in Würde ermöglicht. Und sie hat die Jungen von der Bürde entlastet, finanziell für ihre Eltern sorgen zu müssen. Für jüngere Generationen war und ist die AHV die wohl grösste finanzielle Entlastungsmassnahme aller Zeiten. Diese AHV als Last für die Jungen zu verleumden, ist absurd.
Banken und Privatversicherungen versuchen im aktuellen Abstimmungskampf, die AHV zu diskreditieren und die Generationen gegeneinander auszuspielen. Das ist verständlich: Sie wollen ihre teuren Vorsorgelösungen verkaufen und darum eine schwache AHV.
Tatsache ist: Bei der AHV erhalten neun von zehn Personen mehr, als sie einbezahlt haben. Das hat zwei Gründe. Erstens zahlen Arbeitgeber für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter den gleich hohen AHV-Beitrag wie die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter selber. Zweitens zahlen alle einen fixen Prozentsatz des Lohns als AHV-Beitrag. Sergio Ermotti mit seinem Millionenlohn zahlt also in Franken und Rappen ein X-Faches mehr AHV-Beiträge als seine Putzfrau. Ermotti erhält im Pensionsalter dann aber höchstens doppelt so viel AHV-Rente als seine Putzfrau.
Daran ändert sich nichts, wenn es neu 13 statt 12 Monatsrenten gibt. Wenn wir die 13. AHV-Rente annehmen und mittelfristig die Beiträge um ein paar Lohnpromille erhöhen müssen, profitieren besonders auch die Rentnerinnen und Rentner von morgen. Neun von zehn von ihnen werden weiterhin mehr Geld als Rente beziehen, als sie mit AHV-Beiträgen einzahlen mussten.
Die Abstimmung über die 13. AHV-Rente ist also kein Konflikt zwischen Jung und Alt. Wenn schon, dann ist es eine Auseinandersetzung zwischen der Finanzbranche und den reichsten 10 Prozent auf der einen Seite und dem Rest der Bevölkerung auf der anderen Seite.
Wer im Abstimmungskampf die Generationen gegeneinander ausspielt, greift letztlich die Grundlagen unserer genialen AHV an. Dass die Finanzbranche das aus Eigeninteresse tut, ist nicht erstaunlich. Dass so viele Medienschaffende, auch von dieser Zeitung, in den Kommentaren den Teufel an die Wand malen und den Generationenkonflikte herbeischreiben, ist hingegen unverständlich.
Darum bin ich dankbar, hier das Gegenteil schreiben zu dürfen: Stärken wir am 3 März unser wichtigstes Sozialwerk, stärken wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine 13. AHV-Rente sollte so selbstverständlich sein wie der 13. Monatslohn. Sie kompensiert den Rentenrückstand der letzten Jahre. Im Interesse der Älteren und der Jüngeren.
Dieser Text ist am 28. Februar 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Die Krankenkassenprämien explodieren, die Mieten steigen, Energie und Lebensmittel werden teurer. Die Kaufkraft der Bevölkerung bricht weg, weil Löhne und Renten mit der genannten Entwicklung nicht mithalten. In der Altersvorsorge kommt das Problem hinzu, dass die Pensionskassenrenten seit Jahren sinken. Fünfzehn Prozent der heutigen Rentenbeziehenden leben in einem Haushalt mit höchstens 10’000 Franken finanzieller Reserve und rund 300’000 sind armutsgefährdet. Für zu viele reicht die Rente nicht mehr. Und auch viele heutige und künftige Rentner:innen der Mittelschicht blicken finanziell in eine schwierige Zukunft. Kein Wunder ist die 13. AHV-Rente eine sehr populäre Forderung!
Über die entsprechende Volksinitiative der Gewerkschaften stimmen wir am 3. März ab. Eine 13. Monatsrente bringt zusätzlich 1’225 bis 2’450 Franken für Einzelpersonen und bis zu 3’675 Franken für Ehepaare pro Jahr. Ein angemessener Ausgleich für den erwähnten Kaufkraftverlust.
Die Gegner:innen führen zwei Argumente gegen diese Volksinitiative ins Feld. Zum einen sagen sie, es würden auch Menschen profitieren, die es nicht nötig hätten. Dabei ist die viel kritisierte Giesskanne gerade das Wesen der AHV. Alle bekommen nach der Pensionierung AHV, auch Reiche und Superreiche. Aber niemand bekommt mehr als die Maximalrente von 2’450 Franken. Hingegen kennt die Finanzierung über die Lohnprozente keinen Deckel. Darum ist die AHV die einzige Säule der Altersvorsorge, von der die Reichen genau nicht profitieren. Die acht Prozent der Bevölkerung, die am meisten verdienen, zahlen über ein Arbeitsleben statistisch mehr ein, als sie bis zum Lebensende ausbezahlt bekommen. Die übrigen 92 Prozent erhalten mehr, als sie einzahlen. Ob es nun zwölf oder dreizehn Monatsrenten gibt, ändert nichts an diesem fantastischen Kosten-Nutzen-Verhältnis für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung.
Das zweite Gegenargument lautet, wir könnten uns eine zusätzliche Monatsrente nicht leisten. Auch dieses sticht nicht. Im Moment nimmt die AHV deutlich mehr ein, als sie ausgibt. Die Reserve zum Jahreswechsel betrug rund 50 Milliarden Franken. Bis 2030 kann man die 13. Rente wohl ohne Zusatzfinanzierung decken. Und danach würde eine moderate Erhöhung der Lohnprozente ausreichen, um die 13. Rente zu finanzieren. Über 90 Prozent der Bevölkerung würden unter dem Strich immer noch mehr Rente bekommen, als sie einbezahlt hätten. Der 13. AHV-Rente können wir also trotz Panikmache der AHV-Schlechtredner mit gutem Gewissen zustimmen.
Am gleichen Tag stimmen wir auch über die Renteninitiative der Jungfreisinnigen ab, die das Rentenalter in einem ersten Schritt auf 66 Jahre erhöhen und es anschliessend an die durchschnittliche Lebenserwartung koppeln will. Das Anliegen ist aus mindestens drei Gründen abgehoben und unsozial.
Erstens: Ein höheres Rentenalter trifft real nur die tiefen und mittleren Einkommen. Wer es sich leisten kann, lässt sich in den meisten Fällen so oder so früher pensionieren. Wenn das Rentenalter steigt, müssen also Detailhandelsangestellte oder Pflegefachpersonen noch länger arbeiten, während Investmentbankerinnen oder Professoren weiterhin in Frühpension gehen können. Das ist doppelt ungerecht, weil die Lebenserwartung von Menschen mit tiefen Einkommen geringer ist. Die Initiative trifft also diejenigen am stärksten, die härter arbeiten, tendenziell bei schlechterer Gesundheit sind und ohnehin weniger lang Rente beziehen können.
Zweitens: Ein Jahr vor dem aktuell geltenden Rentenalter arbeitet nur noch die Hälfte der Menschen. Sehr viele unfreiwillig. Auf dem Arbeitsmarkt sind die Perspektiven für ältere Arbeitnehmende schlecht, weil zu wenige Arbeitgeber ihnen eine Chance geben. Eine Erhöhung des Rentenalters würde diese entwürdigende Situation noch verschärfen.
Drittens: Ein höheres Rentenalter bedeutet, länger zu arbeiten und weniger lang Rente zu beziehen – faktisch also eine weitere Rentenkürzung. Dabei bräuchten viele Rentenbeziehenden wie erwähnt endlich einen Ausgleich für die höheren Kosten und die Ausfälle bei der ersten Säule.
Die Initianten argumentieren, dass wir die Erhöhung des Rentenalters brauchen, um die Finanzierung der AHV zu sichern. Die Alterung der Gesellschaft würde uns gewissermassen dazu zwingen. Denn bei der AHV-Gründung sei das Verhältnis zwischen den Aktiven und den Rentenbeziehenden noch 6:1 gewesen, während es heute bei 3:1 und schon bald bei 2:1 liege. Doch diese Aussage stimmt nicht. In der Gründerzeit der AHV gab es nie sechs Aktive, die eine Person in Rente finanzierten. Denn in den 50er-Jahren gab es nur ganz wenige Frauen, die für Lohn arbeiteten. In der damaligen patriarchalen Gesellschaft mussten die meisten Frauen zuhause bleiben, weshalb praktisch nur die Männer die AHV finanzierten durften. Das ist heute zum Glück anders. Die grosse Mehrheit der Frauen ist berufstätig und finanziert die AHV mit. Das kompensiert die steigende Anzahl der Rentenbeziehenden zu einem erheblichen Teil.
Fazit: Die Bevölkerung sollte sich nicht von der Panikmache der AHV-Schlechtredner beeinflussen lassen. Eine 13. AHV-Rente ist angezeigt, sicher nicht ein höheres Rentenalter!

Dieser Jahresbeginn ist für die Berner Politik auch ein Aufbruch in die neue Legislatur. Gerne hätte ich ihn als Bundesrat in Angriff genommen, die Bundesversammlung hat bekanntlich eine andere – gute! – Wahl getroffen. Ich freue mich nun auf die Arbeit im Parlament und wünsche Beat Jans sowie den sechs wiedergewählten Bundesrätinnen und Bundesräten viel Kraft und Glück bei der Bewältigung der grossen Herausforderungen unseres Landes.
Die Schweiz ist Teil einer gefährlicher werdenden Welt. Die Klimakrise. Der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Der islamistische Terror. Der aufgeflammte Hass des Antisemitismus und des antimuslimischen Rassismus. Der Krieg und die humanitäre Katastrophe in Gaza, welche die Stabilität im gesamten Nahen Osten gefährden. Eine fragile Demokratie, die von autoritären Kräften auf allen Kontinenten angegriffen wird. Eine unsichere wirtschaftliche Entwicklung, die nach wie vor viel zu grosse soziale Ungleichheiten produziert. Der technologische Wandel, der wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewissheiten umpflügt. All diesen höchst anspruchsvollen Tatsachen muss die Politik mit Mut begegnen.
Aussenpolitisch sollten wir zu internationalen Lösungen beitragen, welche die liberale Demokratie und eine regelbasierte Weltordnung überleben lassen. Damit die Schweiz als kleines, freies Land sicher bleiben kann. Und damit wir beitragen zur Linderung von Not und Armut, zur Achtung der Menschenrechte, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, zum Frieden in der Welt.
Diese Ziele unserer Bundesverfassung müssen wir in konkrete Politik für eine gerechte Welt umsetzen. Es braucht mehr humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, mehr Friedensförderung und internationale Klimapolitik. Es braucht eine moderne Auslegung unserer Neutralität, welche die Schweiz als glaubwürdige Anwältin des Völkerrechts positioniert. Und es braucht endlich eine solide Klärung unserer Beziehung zur EU – der besten Nachbarin, die die Schweiz je hatte.
Innerhalb unseres Landes werden Krankenkassenprämien, Mieten und Energie immer teurer, während Löhne und Renten nicht mithalten können. Das spüren besonders die Familien und diejenigen Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, bescheiden leben und trotzdem kein Vermögen anhäufen können. Dabei ist es gerade die arbeitende Bevölkerung, die jeden Tag das Fundament des Schweizer Wohlstands baut.
Der Job weitsichtiger Innenpolitik wäre es darum, die Kaufkraft und die soziale Sicherheit der Bevölkerung zu erhalten und gezielt zu stärken. Dies würde auch den Zusammenhalt unseres Landes und unserer Gesellschaft in schwierigen Zeiten garantieren. Gerade in diesem Bereich hat die Parlamentsmehrheit aber noch viel Verbesserungspotential. Darum muss wohl das Volk für Fortschritt sorgen.
Schon am 3. März können wir eine 13. AHV-Rente beschliessen und so die Kaufkraft der Älteren stützen. Und im Juni können wir die Höhe der Krankenkassenprämien auf maximal zehn Prozent des Haushaltseinkommens deckeln und so die Familien und die arbeitende Mittelschicht endlich spürbar entlasten. Unser aller Engagement für eine soziale Schweiz lohnt sich darum allemal!
Dieser Text ist am 10. Januar 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Der schreckliche Krieg gegen die Ukraine zieht sich in die Länge, die Menschen vor Ort sind müde und in Westeuropa nimmt die Aufmerksamkeit für ihre Nöte ab. Und immer wieder begegnet man dem Irrglauben, wonach die Ukraine ihren Verteidigungskampf einstellen sollte, um das unermessliche Leid der Zivilbevölkerung zu beenden. Gewissermassen eine Teilkapitulation aus humanitären Gründen.
Diese Haltung ist zynisch, weil sie den Aggressor belohnt. Und sie sitzt einem Grundlagenirrtun auf, weil ein Erfolg Russlands sicher nicht zum Ende der Gewalt führen würde. Die bisherigen Erfahrungen beweisen das Gegenteil. Nicht nur die völkerrechtswidrigen Bombardements ziviler Infrastruktur, von Restaurants, Wohnhäusern, Spitälern und Geburtshäusern (!) sind eine Tatsache. Auch die Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten sind unerträgliche Realität: die Massenmorde, die Folterkammern, die systematischen Vergewaltigungen und die Deportationen von tausenden Kindern. Eine ukrainische Niederlage wäre folglich nur ein Freipass für weitere Gräueltaten. Humanität und ein Erfolg Russlands schliessen sich aus.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Putin einen imperialistischen Plan verfolgt, den er von Anfang an recht offen deklarierte. Ziel seiner Invasion war es, die Ukraine zu besetzen, die demokratisch gewählte Regierung zu beseitigen und ihm ergebene Marionetten einzusetzen. Letztlich will Putin die ukrainische Nation und ihre junge Demokratie vernichten. Denn in seiner verqueren Weltsicht existiert gar kein ukrainisches Volk, weshalb er sich berechtigt fühlt, alles mit diesen Menschen zu machen. Ohne mit der Wimper zu zucken, geht er darum über zehntausende von Leichen.
Darum unterstützt Europa die Ukraine mit humanitärer Hilfe, einer grosszügigen Aufnahme der Flüchtenden, Wirtschaftssanktionen gegen Russland, direkten Finanzhilfen und vielen Waffen. Damit verteidigt unser Kontinent nichts weniger als die Stärke des Rechts gegenüber dem Recht des Stärkeren. Und damit auch die eigene Freiheit. Nur wenn sich aufgrund einer starken Ukraine Putins Kosten-Nutzen-Kalkül verändert, kann es zielführende Verhandlungen geben.
Auch die Schweiz kann und muss mehr tun. Wir müssen weiter solidarisch sein mit den Geflüchteten. Wir müssen das System Putin schwächen, indem wir die Sanktionen endlich konsequent umsetzen. Wir müssen inländische Kriegsgewinnler wie die Rohstoffhändler an die Kandare nehmen und ihre Übergewinne zugunsten der Ukraine besteuern. Und wir müssen endlich unser Geldwäschereigesetz verschärfen.
Wir müssen dem ukrainischen Volk beistehen, indem wir deutlich mehr humanitäre und finanzielle Hilfe leisten. Und wir müssen unsere Neutralität richtig auslegen, damit sie dem Völkerrecht dient und nicht den Aggressor schont. Darum ist auch die Wiederausfuhr von bereits verkauften Schweizer Waffen an die Ukraine durch unsere Nachbarstaaten zu erlauben.
Angesichts von Russlands Imperialismus braucht die Schweiz ein neues Selbstverständnis als Anwältin des Völkerrechts und der Menschenrechte. Darum muss sie engagiert auf der Seite der Ukraine stehen. Nur so kann sie sich glaubwürdig Menschlichkeit und Demokratie auf die Fahne schreiben.
Dieser Text ist am 16. August 2023 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Der New Yorker Verkehrsexperte Lewis Mumford wusste schon vor 70 Jahren: Mehr Strassen bauen ist wie «seinen Hosengürtel öffnen, um Übergewicht loszuwerden.» Wer die Strassen ausbaut, schafft mehr Verkehr. Das ist wissenschaftlich belegt, wie auch der Schweizer Mobilitätsforscher Thomas Sauter-Servaes kürzlich bestätigte: «Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten».
In der Fachsprache heisst das Phänomen «induzierte Nachfrage». Eine Vergrösserung des Angebots führt dazu, dass wir das erweiterte Angebot stärker nutzen als vorher – so dass die Nachfrage bald noch grösser wird als das vergrösserte Angebot.
Die Schweizer Bevölkerung wusste das schon 1994. Damals nahm sie gegen den Willen von Bundesrat und Parlament der Alpeninitiative an und verbot so den Ausbau der Transitstrassen-Kapazitäten in den Schweizer Alpen. Die Mechanismen am Gotthard und am San Bernardino sind die gleichen wie am Gubrist und am Baregg – und wir alle können sie beobachten. Zusätzliche Spuren verschieben den Stau kurzfristig zu neuen Engpässen und ziehen mittelfristig noch mehr Autos und Lastwagen an. Das Problem wird verschärft statt gemildert. Abwegig ist darum auch die immer wieder auftauchende Forderung, dass man die beiden Gotthardröhren nach dem Bau der zweiten Autobahnröhre vierspurig befahren sollte. Die Schweizer Bevölkerung wird die Verfassung nicht ändern, damit wir am Gotthard – und in der Folge auch am San Bernardino – noch mehr Verkehr und Stau bekommen.
Umso unverständlicher entscheidet die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat: Gegen die die Stimmen von SP, Grünen und Grünliberalen hat sie über 5 Milliarden Franken für den Ausbau des Nationalstrassennetzes in den Regionen Bern, St. Gallen, Basel, Schaffhausen und Genfersee beschlossen. Genauso unverständlich ist die Ankündigung des Bundesrats, dass er einen Ausbau der Strecken Bern-Zürich und Lausanne-Genf auf sechs Spuren anstrebt.
Glauben die Bürgerlichen in Bern der Wissenschaft nicht? Verstehen sie das Prinzip der induzierten Nachfrage nicht? Oder ist die Strassen- und Autolobby einfach so mächtig, dass sie Fachargumente einfach in den Wind schlägt?
Letztlich wird die Stimmbevölkerung entscheiden, ob wir uns aus der Logik des ewigen Straussenausbaus und ebenso ewigen Staus befreien. Im Interesse unserer Lebensqualität, des haushälterischen Umgangs mit unserem Boden und des Klimaschutzes sollten wir es unbedingt tun.
Wir sollten den Anteil des Autoverkehrs reduzieren und mehr Mobilität auf den ÖV für längere und auf das Velo für kürzere Strecken verlagern. Damit wir die vorhandenen (grossen!) Strassenkapazitäten optimal nutzen und Staus vermeiden, müssen wir zudem die Verkehrsspitzen brechen. Ein effizientes und intelligentes System der Verkehrssteuerung sowie eine moderne Arbeitsorganisation mit flexibleren Arbeitszeiten können helfen. Nutzen wir also die Chancen der Digitalisierung und denken wir über eine faire Bepreisung des Strassenverkehrs nach. Kurz: Wagen wir mehr Intelligenz statt Beton!
Dieser Text ist am 28. Juni 2023 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.
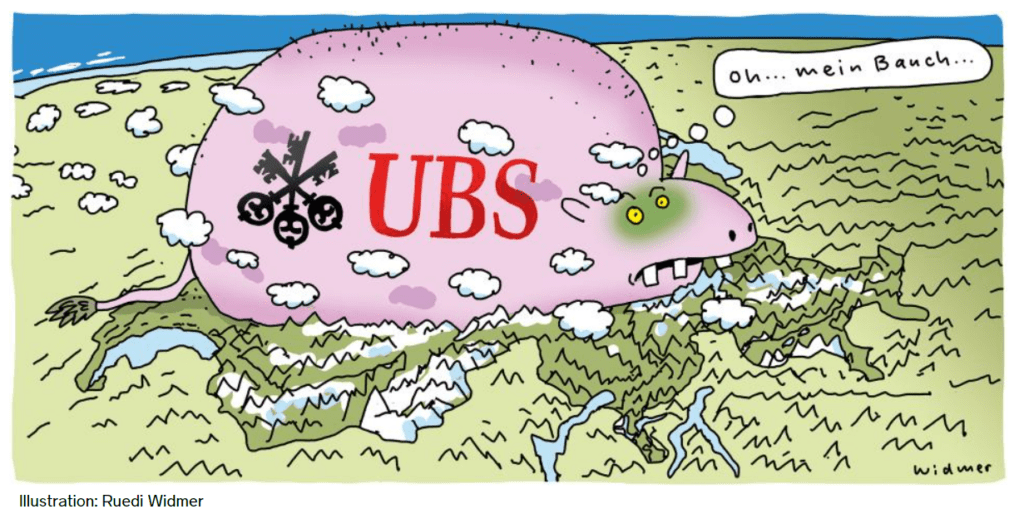
Als Schweizer Sozialdemokrat werde ich ab und zu dafür belächelt, dass unser Parteiprogramm die Überwindung des Finanzkapitalismus als Vision postuliert. Es entbehrte darum nicht einer gewissen Ironie, als der Bundesrat am 19. März feststellen musste, dass der globale Finanzkapitalismus die Schweizer Traditionsbank Credit Suisse überwunden hatte. Dabei war spätestens seit der Finanzkrise und der UBS-Rettung 2009 eigentlich allen klar, dass unkontrollierter Finanzkapitalismus nur Gier und Verantwortungslosigkeit fördert. Genau diese Gier und diese Verantwortungslosigkeit der Paradeplatz-Manager haben in den letzten Jahren und Monaten die zweitgrösste Schweizer Bank pulverisiert. Darum reden heute nur noch hartgesottene Ideologen der Freiheit der Finanzmärkte das Wort.
Denn die Nationalbank – also wir alle – und der Bund – also auch wir alle – mussten mit Garantien im Umfang von unglaublichen 259 Milliarden Franken einspringen, um eine Finanzkrise zu verhindern – 109 Milliarden kamen direkt aus der Bundeskasse. Dass trotzdem tausende Arbeitsplätze in Gefahr sind, zeigt wie krank das System und wie schlecht das vom Bundesrat geschnürte Rettungspaket – also die Zwangsfusion der CS mit der UBS – für uns Bürgerinnen und Bürger ist.
Karin Keller-Sutter und der Bundesrat handelten keinerlei Sicherheiten für den Standort Schweiz und keinerlei Sicherheiten für die Arbeitsplätze aus. Sie holten keine Gewinnbeteiligung der Öffentlichkeit für den Erfolgsfall heraus. Und sie legten der neuen Mega-UBS trotz Anwendung von Notrecht keine strengeren Regeln bei Boni oder Eigenkapital auf. Der Bund trägt für die 109 Milliarden Franken das volle Risiko, kann aber im Erfolgsfall keinen Rappen Gewinn erzielen. Der bleibt vollumfänglich bei der UBS. Ein schlimmeres Beispiel für das unsägliche Prinzip «Gewinne privat, Kosten dem Staat» kann man sich kaum vorstellen.
Zu Recht hat der Nationalrat diesen grottenschlechten Deal an der ausserordentlichen Session zur CS im April abgelehnt. Und an der Sondersession letzte Woche hat der Nationalrat endlich zwei SP-Motionen angenommen, die bei systemrelevanten Banken Boni einschränken und Eigenkapitalvorschriften verschärfen wollen. Zumindest für den Moment scheint sich die grosse Kammer im Bern etwas vom Paradeplatz emanzipiert zu haben.
Das ist auch dringend nötig. Denn die UBS, die sowieso schon viel zu gross war, ist jetzt noch viel grösser. «Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht», hat die NZZ sehr treffend geschrieben. Dieses Monster muss sofort gezähmt werden. Darum braucht es ein Bonus-Verbot für die Teppichetagen der systemrelevanten Banken. Nur so kann die absurde Logik durchbrochen werden, wonach die Gierigsten für die Besten gehalten werden. Das Monster muss aber auch schnell eingehegt werden. Darum braucht es rasch eine deutlich höhere Eigenkapitalquote und auch eine zünftige Abgeltung der faktischen Staatsgarantie für die Öffentlichkeit. Nur so kann sich die Schweiz ein wenig aus der Geiselhaft der Monster-UBS befreien und das Prinzip «Gewinne privat, Kosten dem Staat» überwinden. Denn damit muss nach zwei notrechtlichen Bankenrettungen definitiv Schluss sein!
Dieser Text ist am 10. Mai 2023 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.
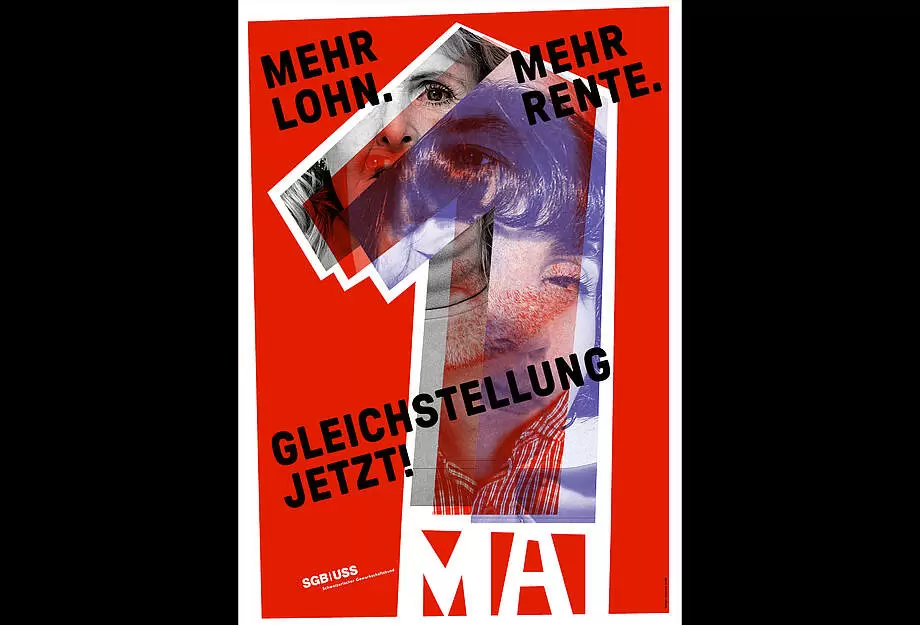
«Systemrelevant» – dieses Wort ist wieder in aller Munde. Grosse Banken seien angeblich systemrelevant. Darum musste nach der UBS 2009 nun auch die CS mit Milliarden der Bürgerinnen und Bürger gerettet werden. Dass die Casino-Banken wirklich systemrelevant sind, würde ich bezweifeln. Zumindest nicht für ein gutes System. Klar ist aber: Grossbanken sind schlicht zu gross und zu mächtig, um fallengelassen zu werden.
Wirklich systemrelevant sind andere: die Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Bähnlerinnen und Chauffeure, die Kindergärtner und Lehrerinnen, die Verkäuferinnen und Lageristen, die Elektroinstallateure und Polizistinnen, die Pflegerinnen und Bauarbeiter, die Sozialarbeiter und die Sanitärinnen, die Köche und die Apothekerinnen, die Sekretärinnen und die Strassenkehrer – sie alle und viele mehr sind es, die jeden Tag dafür sorgen, dass unser Leben funktioniert. Mit ihrer Erwerbsarbeit einerseits und mit ihrer unbezahlten Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit andererseits.
«Let’s drink to the hard working people, let’s drink to the salt of the earth», singt Mick Jagger in der legendären Working-Class-Hymne der Rolling Stones. Als agnostischer Mensch habe ich gewisse Hemmungen vor Bibelzitaten und doch finde ich: Jagger und die Stones haben Recht. Die hart arbeitenden Menschen schaffen die Werte unserer Wirtschaft. Sie sorgen für Fortschritt und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Durch sie entsteht Würde für und Zugehörigkeit unter Menschen. Sie sind tatsächlich das Salz der Erde!
Umso nötiger war es, dass unsere Genossin und Freundin Jacqueline Badran gestern in der Sonntagszeitung darauf aufmerksam gemacht hat, dass die arbeitenden Menschen viel zu wenig Sichtbarkeit erhalten, oft geradezu vergessen werden. Von der Politik oder auch in den Medien. Sie fragt zu Recht: Warum gibt es zum Beispiel ein «SRF Börse» aber kein «SRF Arbeit»?
Dabei wissen eigentlich alle: Fallen einmal für eine Woche alle CEOs und Verwaltungsrätinnen oder auch alle Regierungsrätinnen und Nationalräte aus, dann passiert – gar nichts! Fallen einmal für eine Woche alle Pflegerinnen oder alle Bähnler aus – das Land stünde am Abgrund!
Deshalb feiern wir am 1. Mai die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und in den übrigen 364 Tagen des Jahres engagieren wir uns für einen fundamentalen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Wandel in unserer Gesellschaft. Dafür, dass die Arbeit endlich den Respekt und die Anerkennung erhält, die sie verdient. Für eine soziale Wende in Wirtschaft und Politik.
Wie nötig diese ist, konnte ich die letzten Monate in Bern hautnah miterleben.
Während der Bundesrat die CS mit 259 Milliarden und ohne Sicherheiten für die Bevölkerung gerettet bzw. der UBS verschenkt hat, verweigerten Bundesrat und Parlament den Rentnerinnen und Rentnern den vollen Teuerungsausgleich.
Während die Parlamentsmehrheit das Militärbudget um Milliarden erhöhte, hat die gleiche Mehrheit mit der neusten BVG-Revision eine massive Rentensenkung in der beruflichen Vorsorge beschlossen.
Während die Mieten explodieren und sich immer mehr Menschen – gerade in unserem Kanton – das Wohnen kaum mehr leisten können, beschliessen die Bürgerlichen im Parlament eine Aufweichung des Mietrechts.
Während die arbeitende Bevölkerung letztes Jahr im Durchschnitt eine Reallohneinbusse von 1.9 Prozent hinnehmen musste, wollen die rechten Parteien in National- und Ständerat die von Volk beschlossenen kantonalen Mindestlöhne schleifen.
Klar: Wir als Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften kämpfen gegen diese unsoziale und schädliche Politik der aktuellen Mehrheit in Bundesrat und Parlament.
Das grottenschlechte Rettungspaket für die CS haben wir abgelehnt. Und wir werden nicht ruhen, bis die neue Monster-UBS viel stärker reguliert wird. Ein Bonus-Verbot für die Teppichetage und viel schärfere Eigenkapitalvorschriften sind das Mindeste. Nie wieder dürfen die Kosten und Risiken sozialisiert werden, während die Gewinne privat bleiben.
Mit dem Referendum wehren wir uns gegen die inakzeptable BVG-Revision. Und hier können wir optimistisch sein: Die Bevölkerung wird es nicht akzeptieren, dass sie mehr bezahlen muss, um am Schluss weniger Rente zu haben!
Und natürlich werden wir uns weiterhin für Mindestlöhne, mehr Gesamtarbeitsverträge mit besseren Löhnen, bezahlbare Mieten und tiefere Krankenkassenprämien einsetzen.
Aber das genügt nicht, wir müssen mehr schaffen. Wir müssen eine Bevölkerungsmehrheit für die soziale Wende gewinnen.
Dazu gehört auch ein wirksamer Klimaschutz. Weil wir genau wissen, dass es in einer kaputten Natur keine gute Arbeit und keine soziale Gerechtigkeit geben kann. Darum ist ein Ja am 18. Juni zum Klimaschutzgesetz absolut vordringlich!
Zur sozialen Wende gehört auch endlich mehr Gleichstellung in unserem Land. Am 14. Juni findet wieder der Feministische Streik statt. Sorgen wir dafür, dass er zu einem mächtigen Zeichen gegen die Lohnungleichheit, gegen die Rentenlücke, für Respekt, für gleiche Rechte und Chancen wird!
Dass es eine soziale Wende braucht, beweisen auch die letzten Verlautbarungen des Arbeitgeberverbandes. Statt dem Fachkräftemangel zu begegnen, indem man die Arbeitsbedingungen und die Löhne verbessert, sagen sie, die Leute sollten mehr und länger arbeiten. Die wachsende «Teilzeit-Mentalität» sei schuld an den wirtschaftlichen Problemen. Das ist erstens falsch, weil die Statistik zeigt, dass die Leute im Durchschnitt mehr arbeiten als vor zehn Jahren. Und es ist zynisch und weltfremd, weil die Menschen im Interesse der Volksgesundheit weniger statt mehr arbeiten sollten.
Für die soziale Wende braucht es nicht nur Widerstand gegen solche Angriffe auf die Rechte der Arbeitenden. Es braucht ein kollektives Bewusstsein dafür, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse keine Naturereignisse sind, sondern das Resultat von politischen Entscheidungen. Es ist zum Beispiel nicht einfach Schicksal, dass in der wohlhabenden Schweiz zugleich rund 800’000 Menschen in Armut leben, während die 300 Reichsten ein Vermögen von 821 Milliarden – mehr als das Zehnfache des Bundesbudgets – besitzen.
Diese ungeheure Ungleichheit ist das Resultat einer unsozialen Politik. Und deshalb kann sie auch überwunden werden. Aber wir müssen uns dafür engagieren: politisch, gewerkschaftlich, im Alltag. Damit mehr Menschen erkennen, dass sie Teil einer solidarischen Veränderung sein können. Das ist letztlich die Idee der sozialen Demokratie, für die der Tag der Arbeit steht.
Wie ihr wisst, ist der 1. Mai der einzig wirklich globale Feiertag. Denn der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter um Würde, Freiheit und Gerechtigkeit war und ist ein weltweiter.
Darum schliesse ich mit einigen Gedanken an unsere Genossinnen und Kollegen in anderen Teilen der Welt.
Ich möchte an den doppelten Kampf vieler ukrainischer Arbeiterinnen und Arbeiter erinnern. Sie kämpfen mit der Waffe in der Hand an der Front gegen den imperialistischen Krieg Russlands, damit ihr Land und ihre Demokratie eine Zukunft haben. Und gleichzeitig führen sie eine politische Auseinandersetzung innerhalb der ukrainischen Demokratie gegen die unsozialen Reformen ihrer Regierung. Der Mut und der Durchhaltewille dieser Kolleginnen und Genossen ist unbeschreiblich. Unsere Gedanken sind bei ihnen.
Ich möchte auch an die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Türkei erinnern, die sich unter schwierigsten Bedingungen trotz über 100 Prozent Inflation (!) und einer zum Teil brutalen Repression im aktuellen Wahlkampf engagieren, um am 14. Mai die türkische Demokratie vor dem Autokraten Erdogan zu retten. Auch sie sind eine Inspiration für uns alle.
Und nicht zuletzt möchte ich an die Arbeiterinnen und Aktivistinnen im Iran erinnern. Seit Monaten stehen sie unter Einsatz ihres Lebens auf, um gegen das verbrecherische Mullah-Regime in Teheran zu protestieren. Viele haben schon ihr Leben verloren. Doch viele Frauen und Männer kämpfen weiter. Für «Frau, Leben, Freiheit», wie sie sagen. Also für die Idee der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit. Letztlich für die Werte, die auch den 1. Mai ausmachen.
Wir feiern den Tag der Arbeit, um die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Rechte und unsere Idee der sozialen Gerechtigkeit zu feiern. Und wir fordern eine soziale Wende: Freiheit, Demokratie und Würde für alle, anständige Arbeitsbedingungen, gute Löhne und faire Renten. Hier und überall auf der Welt.
Es lebe der 1. Mai – und hoch die internationale Solidarität!

In quanto doppio cittadino italo-svizzero per me è un onore speciale e un grande piacere parlare qui oggi e celebrare con voi questa importante festa.
Il 25 aprile l’Italia festeggia la liberazione del paese dal flagello del nazifascismo. Celebriamo i valori democratici e quest’anno in particolare i 75 anni della meravigliosa Costituzione della Repubblica Italiana. „La più bella del mondo“, come abbiamo imparato tutti dalle lezioni del maestro Roberto Benigni!
Festeggiamo la Liberazione e la Costituzione sapendo che l’attuale maggioranza politica a Roma e anche l’attuale governo hanno un rapporto complicato, direi penoso con questa festa e i suoi valori.
Trovo vergognoso, ad esempio, che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (lei non vuole esser chiamata “la” Presidente) sia incapace di chiamare la Costituzione italiana per quello che è: profondamente antifascista!
Che lo è, lo si legge con semplicità nei primi due articoli.
Articolo 1, capoverso 1:
„L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.“
E nell’articolo 2:
„La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (…)“.
Non c’è nulla di più antifascista della Repubblica democratica e della garanzia dei diritti umani. È da questa combinazione di scelta democratica e diritti per tutte e tutti che è emersa la più grande idea degli ultimi secoli. L’idea che tutte le persone sono libere e uguali.
Che non importa da dove provieni, quanto siano poveri o ricchi i tuoi genitori, quale sia il tuo genere, la tua identità o il tuo orientamento sessuale, il tuo colore della pelle, la tua religione o le tue convinzioni politiche. Tu hai la stessa dignità e devi avere gli stessi diritti e le stesse opportunità come tutti gli altri.
Questa è la promessa della Repubblica democratica, che naturalmente non è ancora raggiunta. Ma alla quale la comunità deve aspirare.
Le partigiane e gli antifascisti hanno combattuto per questa idea nella Resistenza.
Oggi a Cuneo il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella ha detto molto chiaramente quale sia il legame interno tra la Resistenza antifascista e la Costituzione:
“È dalla Resistenza che viene la Costituzione, e la libertà. Il frutto del 25 Aprile è la nostra Costituzione. La Costituzione come risposta alla crisi di civiltà prodotta dal nazifascismo, stabilendo il principio della prevalenza della persona e delle comunità sullo Stato.”
Nel momento più drammatico della storia italiana, tantissime persone a prescindere dalle loro appartenenze politiche, culturali e religiose, hanno risposto prima di tutto alla loro coscienza per opporsi alla violenza, alla dittatura, all’ingiustizia. Si sono opposte al fascismo. In nome della libertà.
È questa disponibilità al sacrificio, una scelta rischiosa fatta come atto di amore per l’idea di democrazia che non dobbiamo mai dimenticare.
Non dobbiamo dimenticarlo anche quando pensiamo alle sfide del nostro tempo – anche fuori dall’Italia. Per esempio qui in Svizzera.
Quest’anno celebriamo i 175 anni della Svizzera moderna e quindi i 175 anni della prima costituzione almeno in parte democratica di questo paese. Sì, anche la Svizzera è uno Stato democratico che difende i diritti umani. Ma anche qui, come in Italia, ci sono forze che attaccano queste conquiste.
Anche qui ci sono forze che vogliono discriminare, opprimere e privare dei loro diritti le persone. Soprattutto le persone con una storia di migrazione lo vivono ogni giorno. E chi, se non la comunità italiana in Svizzera, conosce questa dolorosa esperienza di esclusione?
Un motivo in più per schierarci tutte e tutti dalla parte di coloro che sono discriminati a causa della loro origine! Non importa quale sia il loro status e se provengono dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Europa dell’Est o da qualunque altra parte del mondo. La loro dignità è anche la nostra dignità!
Ma vogliamo ricordare anche la nostra solidarietà con quelle persone e con quei popoli che lottano per la democrazia e i diritti umani nei loro paesi.
Per esempio, le donne iraniane che ogni giorno si oppongono al terribile regime dei Mullah e rischiano la vita con la loro protesta per difendere libertà e l’uguaglianza.
O l’opposizione turca che, nonostante la terribile repressione da parte del regime di Erdogan, sta conducendo una campagna elettorale difficilissima per ottenere quel cambiamento, che potrà rendere la Turchia dopo il 14 maggio uno Stato di diritto democratico.
O le donne e gli uomini ucraini che combattono, armi alla mano, per la libertà del loro Paese e per la loro autodeterminazione come popolo.
Proprio qui In Svizzera bisogna dirlo: in Ucraina non ci sono semplicemente due parti in guerra, tra cui bisogna restare neutrali. No, da una parte la Russia di Putin conduce un’aggressione imperialista e, almeno in parte, fascista per sottrarre delle terre e per opprimere un popolo. E dall’altra parte un popolo libero lotta per difendere il proprio futuro e la propria autodeterminazione. Se siamo seri riguardo al nostro antifascismo, in questo conflitto dobbiamo stare dalla parte della giustizia e del diritto internazionale. E quindi dalla parte dell’Ucraina.
Festeggiare il giorno della liberazione vuole dire non dimenticare chi nella Resistenza ha combattuto il nazifascismo. Le partigiane e gli antifascisti hanno combattuto per un’idea di libertà e dignità. E oggi, milioni di persone in tutto il mondo stanno tuttora lottando per questa idea. Non dimentichiamoli.
Evviva l’antifascismo, evviva il 25 aprile!
Discorso tenutosi alla festa della liberazione del comitato 25 aprile di Zurigo.

Das Nein zum CO2-Gesetz im Sommer 2021 steckt vielen ökologisch denkenden Bürgerinnen und Bürgern noch immer in den Knochen. Die damalige Vorlage war ein grosser klimapolitischer Kompromiss, der viele Bereiche abdeckte und mit verschiedenen Vorschriften, Förderungen und Lenkungsmassnahmen unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälfte senken sollte. Es scheiterte knapp an einem Referendum der Öl- und Gaslobby. Über die Gründe dieses Neins wurde viel geschrieben. Die Gleichzeitigkeit der Abstimmung mit den beiden Agrar-Initiativen sowie die Schwierigkeit, als ungerecht empfundene Lenkungsmechanismen zu erklären, dürften die beiden wichtigsten gewesen sein. Doch das Sinnieren über die Ursachen der Schlappe bringt nicht viel. Die Schweiz braucht lieber gestern als heute grosse klimapolitische Fortschritte!
Darum hat die SP zusammen mit den Grünen die Klimafonds-Initiative lanciert. Sie begreift die vollständige Dekarbonisierung der Schweiz bis 2050 als Generationenprojekt, welches riesige Investitionen in den Umbau unserer Wirtschaft sowie in die Aus- und Weiterbildung unserer Bevölkerung erfordert. Während unsere Eltern und Grosseltern die AHV erschaffen, die ETH gegründet und die NEAT gebaut haben, wollen und müssen wir die Schweiz in einem Vierteljahrhundert klimaneutral machen. Ein grosszügig gespiesener Klimafonds soll die Finanzierung dieser Herkulesaufgabe sichern. Darüber werden wir mittelfristig abstimmen.
Kurzfristig haben die fortschrittlichen Kräfte im Parlament einen guten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative gezimmert. Nur das wichtige Netto-Null-Ziel in die Verfassung zu schreiben, ist angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise nicht genug. Unser Land braucht Sofortmassnahmen zur Reduktion der Treibhausemissionen. Und wir müssen uns schnell von den Öl- und Gaslieferungen aus dubiosen Staaten unabhängig machen. Darum brachte SP-Fraktionschef Roger Nordmann erfolgreich die Idee ein, den gesetzlichen Gegenvorschlag mit hochwirksamen Investitionshilfen zu ergänzen. Schliesslich bestätigen auch Expertinnen und Experten, dass zusätzliche Gelder für den raschen Heizungsersatz, für Gebäudesanierungen und für den Einsatz klimaschonender Technologien in Unternehmen die grösste und vor allem die schnellste Wirkung haben. Über die kommenden zehn Jahre werden dafür 3.2 Milliarden Franken bereitgestellt. So schaffen wir einen grossen Schritt in Richtung Klimaneutralität von Gebäuden und Wirtschaft.
Das von SP, Grünen, Grünliberalen, Mitte und FDP unterstütze «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» bring den Klimaschutz voran, schafft Arbeitsplätze und macht uns unabhängiger von Öl- und Gasimporten. Verliererinnen oder Verlierer gibt es keine.
Trotzdem hat die SVP das Referendum dagegen ergriffen – mit fadenscheinigen Gründen. Statt die Klimakrise endlich ernst zu nehmen und die Versorgungssicherheit der Schweiz zu stärken, macht sie mit populistischen Parolen das Geschäft der Öl- und Gaslobby. Doch die Bevölkerung wird sich bei der Abstimmung am 18. Juni nicht über den Tisch ziehen lassen. Die Argumente sprechen eine zu klare Sprache. Diesmal gewinnt das Klima!
Dieser Text ist am 1. Februar 2023 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Ein politisches Amt auszuüben ist keine Selbstverständlichkeit. Das darf es in der Demokratie auch nie werden. Darum habe ich mir genau und kritisch überlegt, ob ich bei den Wahlen im Oktober noch einmal antreten soll oder nicht.
Ich empfinde es als grosses Privileg, die Bündner Bevölkerung und die progressiven Werte der Sozialdemokratie in Bern vertreten zu dürfen. Und ja, das Amt als Nationalrat macht mir Spass!
In der laufenden Legislatur konnte ich im Parlament und innerhalb der Parteileitung der SP Schweiz einiges bewegen. Zum Beispiel war ich als Vizepräsident und dann als Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen daran beteiligt, den Öffentlichen Verkehr in der Covid19-Krise finanziell zu stützen, der Verlagerungspolitik neuen Schub zu geben oder die Dekarbonisierung der Busse voranzutreiben. Als Vizepräsident der SP Schweiz habe ich die Neuausrichtung unserer Europapolitik geprägt und konnte mithelfen, der Klimapolitik das nötige Gewicht zu geben. Diese Arbeiten möchte ich fortsetzen und weiter für eine soziale, ökologische und europäische Schweiz Partei ergreifen.
Darum stelle ich mich für eine Widerwahl zur Verfügung. Sofern mich der Parteitag der SP Graubünden am 15. April nominiert und die Bevölkerung am 22. Oktober wiederum wählt, bleibe ich voller Motivation weitere vier Jahre Bündner Nationalrat.
Der Einstieg in dieses Wahljahr war aber nicht nur einfach. Denn durch die Entscheidung von Sandra Locher Benguerel, nicht wieder zu kandidieren, verlieren die Schweiz, Graubünden und die SP eine hervorragende Nationalrätin. Persönlich verliere ich zudem ein super Gspänli für den Wahlkampf und im Falle einer Wiederwahl auch meine Banknachbarin und beste Freundin in Bern. Diese Vorstellung schmerzt, denn wir sind wirklich ein super Team in Bern. Eine freundschaftlichere, vertrauensvollere und auch wirksamere Zusammenarbeit als Sandra und ich sie haben, kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Umso mehr freue ich mich, dass sie noch einige Monate andauern wird!
So bedauerlich der Entscheid von Sandra für das Land und für mich persönlich ist – um die SP Graubünden müssen wir uns keine Sorgen machen. Unsere Kantonalpartei ist programmatisch, strategisch und auch personell ausgezeichnet aufgestellt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Wahlen im Oktober gewinnen und beide Bündner SP-Sitze im Nationalrat verteidigen können. Dafür brauchen wir einmal mehr einen ausgezeichneten Wahlkampf und das Engagement all unserer Mitglieder und Sympis. Packen wir es an!

Letzte Woche hat die Vereinigte Bundesversammlung zwei neue Mitglieder des Bundesrates gewählt. Besonders die Wahl der Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider versetzte den Berner Polit- und Medienbetrieb in Aufregung und strafte manchen Auguren Lügen. In der medialen Aufregung um die vermeintliche Niederlage der Städte ging fast unter, dass erstmals der Kanton Jura im Bundesrat vertreten ist. Wie schon Andrea Masüger in dieser Zeitung (als einer der wenigen Kommentatoren!) treffend schrieb, darf die staatspolitische Bedeutung dieses Entscheids nicht unterschätzt werden.
Auf dem Bundesplatz wehten nach der Wahl jurassische und Berner Flaggen nebeneinander, die Menschen aus beiden Kantonen feierten – und zwar gemeinsam! Wer die äusserst schwierige, auch von Gewalt gezeichnete Ablösungsgeschichte des Juras vom Kanton Bern kennt, freut sich über diese versöhnliche Wahl. Wieder einmal stellen die Schweizer Institutionen ihre Integrationskraft unter Beweis. Ebenso erfreulich ist die Wahl der zehnten Schweizer Bundesrätin. Für ein Land wie die Schweiz, das gleichstellungspolitisch im Rückstand liegt und deshalb 2019 über eine halbe Million Menschen auf die Strassen trieb, wäre das Fehlen einer linken Frau in der Landesregierung schlicht unhaltbar.
Im Schatten der Bundesratswahlen haben die Räte letzte Woche auch ein ausgeglichenes Budget für das Jahr 2023 verabschiedet. Doch der Finanzplan zeigt, dass schon bald schwierige Verteilungskämpfe ausbrechen könnten. Hauptgrund dafür ist die überhastete und sachlich unkluge Erhöhung der Armeeausgaben.
Als Wladimir Putin im Februar seinen verbrecherischen Angriff gegen die Ukraine befahl, zertrümmerte er nicht nur das Völkerrecht und die europäische Sicherheitsarchitektur. Er setzte auch eine regelrechte Aufrüstungsspirale in Europa in Gang. Alle Staaten überschätzten Russlands militärisch Stärke. Statt wie geplant – und von Vielen vorausgesagt – überrollte Russland die Ukraine nicht in einer Woche. Im Gegenteil: Putins Regime erleidet seit fast zehn Monaten eine militärische Niederlage nach der anderen. Natürlich kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer heldenhaft. Ihnen hilft aber auch, dass Russlands Waffensysteme denen des Westens klar unterlegen sind. Das erstaunt nicht, wenn man bedenkt, dass die USA zehn Mal mehr und Europa doppelt so viel für die Armee ausgeben als Russland. Dass auch die neutrale Schweiz, die ohnehin keine Waffen liefern darf, ebenfalls massiv aufrüsten soll, ergibt weder sicherheitspolitisch noch finanziell Sinn. Zumal unser Land schon heute eine überdimensionierte Armee hat. Geradezu absurd wird die von den Bürgerlichen durchgedrückte Aufstockung des Militärbudgets, wenn man sich vor Augen führt, dass das VBS noch gar nicht weiss, was es mit dem vom Parlament beschlossenen Geld beschaffen soll.
Stattdessen wissen wir alle, was die Priorität für eine sichere und souveräne Schweiz wäre: Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz und in den ökologischen Umbau unseres Landes. Nur so leisten wir einen Beitrag gegen die grösste Bedrohung – die Klimakrise – und machen uns von den Diktatoren dieser Welt unabhängig. Es bleibt zu hoffen, dass der neu zusammengesetzte Bundesrat die Prioritäten wieder richtig setzt.
Dieser Text ist am 14. Dezember 2022 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Nach spannender Debatte hat der Basler Parteitag am 29. und 30. Oktober mit 293 zu 84 Stimmen bei 20 Enthaltungen das von unserer Arbeitsgruppe erarbeitete Europapapier verabschiedet. Als SP ergreifen wir damit klar Partei für eine europäische Schweiz in einem sozialen und demokratischen Europa. Mit einer Strategie aus drei Schritten.
Schritt 1: Die Verhandlung eines befristeten Stabilisierungsabkommens mit der EU, das die Schweizer Teilnahme an verschiedenen EU-Programmen in den Bereichen Forschung, Bildung oder Kultur regelt (Horizon, Erasmus etc.). Im Gegenzug verpflichtet sich die Schweiz ihren Kohäsionsbeitrag zu erhöhen und die Verhandlungen über die Regeln zur Teilnahme am EU-Binnenmarkt wieder aufzunehmen. Ein solches Abkommen sollte bis Ende 2023 vorliegen. Dass diese SP-Idee kein Hirngespinst ist, haben wir im Parlament bewiesen. Am 13. Juni hat der Nationalrat einer entsprechenden Motion zugestimmt. Im Anschluss haben dann alle grossen Fraktionen des EU-Parlaments diese Idee in einem Brief an die EU-Kommission explizit unterstützt. Der Ball liegt nun beim Ständerat.
Schritt 2: Die Verhandlung eines Wirtschaftsabkommens, das die institutionellen Marktzugangsfragen im Sinne einer Assoziierung regelt. Optimal wäre der Abschluss eines solchen Abkommens bis 2027, was im Sinne einer Garantie gegenüber der EU so auch im Stabilisierungsabkommen zu vereinbaren ist. Für die innenpolitische Abstützung und Legitimation dieses Assoziierungsprozesses sollen dessen Rahmenbedingungen in einem Europagesetz geregelt werden. Einer entsprechenden parlamentarischen Initiative aus der SP-Küche hat der Nationalrat schon im März zugestimmt. Auch diesbezüglich ist nun der Ständerat am Zug.
Schritt 3: Auf Basis eines dannzumal geregelten Verhältnisses mit der EU will die SP über den Beitritt der Schweiz verhandeln. Unser Land soll dort mitgestalten, wo die Politik in und für Europa im 21. Jahrhundert entschieden wird. Denn echte Souveränität gibt es heute nur mit europäischer Mitbestimmung. Zudem würde die Schweiz von einer in vielen Bereichen progressiven EU-Politik profitieren. Bei der Gleichstellung, beim Konsument:innenschutz oder bei den Klimazielen ist die EU deutlich weiter als die Schweiz. Klar ist aber auch, dass ein EU-Beitritt insbesondere in den Bereichen Lohnschutz, Service Public und direkte Demokratie gut ausgehandelt und flankiert werden muss.
Natürlich ist die EU bei weitem nicht perfekt. Sie braucht – wie die Schweiz! – soziale und demokratische Reformen. Diese wollen wir zusammen mit unseren Genoss:innen und Freund:innen in ganz Europa anpacken. Für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt auf unserem Kontinent.
Dieser Text ist in der Ausgabe 203 im November 2022 der Mitgliederzeitung der SP Schweiz LINKS erschienen.

Wir erleben die schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten. Es droht eine Energiemangellage und die hohen Strompreise bringen Unternehmen und Haushalte in Bedrängnis. Auslöser ist Putins verbrecherischer Krieg. Um den westlichen Zusammenhalt und die Unterstützung für die Ukraine zu brechen, setzt der russische Diktator seinen Gashahn als Waffe gegen Europa ein.
Seit Jahrzehnten engagieren sich fortschrittliche Kräfte für einen raschen Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien. Schon 1982 fordert zum Beispiel die SP Schweiz in ihrem Parteiprogramm mehr Energieerzeugung durch Sonne, Wind, Erdwärme, Biogas, Holz und Wasserkraft, um parallel aus Öl, Gas und Atom aussteigen zu können. Diese Energiewende war und ist für den Klimaschutz unerlässlich. Und sie war und ist notwendig, um uns von der Abhängigkeit von despotischen Regimes zu befreien.
Leider wurde diese weitsichtige Strategie in den vergangenen vierzig Jahren von denjenigen Kräften hintertrieben, die den Klimawandel leugneten oder der mächtigen Öl- und Gas-Lobby auf den Leim gingen. Im Parlament blockierte eine Koalition aus SVP, FDP und Teilen der ehemaligen CVP jahrelang die nötige Wende. Hätten sich die SP und ihre Verbündeten durchgesetzt, wären wir heute praktisch immun gegen Putins Aggression.
Auch die Atomlobby hat die notwendige Transformation gebremst. Erst die Katastrophe in Fukushima brachte eine politische Kurskorrektur. Klar, kurzfristig brauchen wir die bestehenden Atomkraftwerke noch. Aber für die Zukunft ist die Atomkraft keine Option. Sie bleibt ein Grossrisiko und das Atommüllproblem ist nach wie vor ungelöst. Die Tatsache, dass momentan 24 der 56 französischen Atomreaktoren stillstehen, zeigt, welches Klumpenrisiko diese Technologie auch für die Versorgungssicherheit darstellt.
Die einzige zukunftsfähige Option ist die Energiewende: mehr Energieeffizienz und ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere der Sonnenenergie, wo das Potential mit Abstand am grössten ist. Wegen der akuten Energiekrise begreifen das in Bern nun auch Bürgerliche, die bis vor kurzem skeptisch waren. Diese späte Einsicht ist nötig und erfreulich!
Verwerflich ist hingegen, wenn zum Beispiel die SVP, die für die Verspätung der Energiewende hauptsächlich verantwortlich ist, nun Sündenböcke vorschiebt. Bundesrätin Simonetta Sommaruga oder Linke und Grüne sollen Schuld daran haben, dass wir noch nicht genug Sonnen- oder Windstrom produzieren. Dabei hat die SVP zusammen mit bürgerlichen Verbündeten über Jahre den Zubau von erneuerbaren Energien verhindert. Zum Beispiel indem die Beiträge für Photovoltaikanlagen gedeckelt, die Kostendeckende Einspeisevergütung befristet und jegliche Solardachpflicht verhindert wurden. Im Vergleich dazu sind ein paar Einsprachen der Umweltschutzorganisationen ein Klacks, zumal diese gar nicht unbedingt dem linken Lager zugeordnet werden können. Präsident der kritischen Stiftung Landschaftsschutz ist zum Beispiel FDP-Nationalrat Kurt Fluri.
Unser Land braucht rasch eine umfassende Energiewende. Alle müssen mithelfen und Kompromisse eingehen. Was wir definitiv nicht brauchen, ist eine Sündenbockpolitik derjenigen, die die Energiewende viel zu lange gebremst haben.
Dieser Text ist am 3. November 2022 als Gastkommentar im Bündner Tagblatt erschienen.

Die Schweiz hat eines der besten Gesundheitssysteme. Aber auch eines der teuersten der Welt. Jährlich werden über 80 Milliarden Franken darin umgesetzt, rund 12 Prozent unserer gesamten Wirtschaftsleistung. Grundsätzlich ist das ein gutes Zeichen. Wir leben länger und oft besser, haben Zugang zu modernsten Therapien und Medikamenten, das medizinische Fachpersonal ist bestens qualifiziert (wenn auch im Fall der Pflege unterbezahlt!) und unsere Spitäler wirken in vielen Fällen fast wie schöne Hotels. Zudem ist eine Volkswirtschaft sympathischer, die eine Verbesserung der Gesundheit anstrebt statt einer Aufblähung des Finanzsektors oder den Ausbau der Rüstungsindustrie.
Natürlich gibt es auch im Gesundheitswesen Sparpotenzial. Handlungsbedarf besteht bei den überhöhten Medikamentenpreisen, den übertriebenen Tarifen gewisser Spezialisten, den hohen Verwaltungskosten der Krankenversicherungen oder bei den oft dysfunktionalen marktwirtschaftlichen Anreizen.
Trotzdem sind nicht die Gesamtkosten unseres Gesundheitswesens das Hauptproblem, sondern deren Verteilung. Denn sowohl die zu hohen Prämien als auch die selbst zu tragenden Zahlungen zum Beispiel für Franchisen, Selbstbehalte, Medikamente oder Zahnbehandlungen sind für immer mehr Haushalte kaum noch zu tragen. In keinem anderen OECD-Land sind die Eigenleistungen der Bürgerinnen und Bürger höher. Diese individuellen Gesundheitskosten sind neben den Mieten die grössten Kaufkraftfresser für die Schweizer Mittelschicht.
Hier muss die «Berner Politik» ansetzen, wenn sie auf der Seite der Bevölkerung stehen will. Und zwar nicht, indem sie Leistungen kürzt und so noch stärker in Richtung Zweiklassenmedizin steuert. Schon heute verzichten gemäss Erhebung des Schweizer Gesundheitsobservatoriums rund 11 Prozent der Bevölkerung aus Kostengründen auf einen Arztbesuch, obwohl dieser medizinisch sinnvoll wäre. Ein beschämender Befund für die Schweiz!
Was die Politik dringend angehen muss, ist eine sozialere Finanzierung des Systems. Trotz (zu) bescheidener Prämienverbilligung ist die Belastung für viele Familien sehr hoch. Im Durchschnitt müssen Mittelschichtsfamilien rund 15 Prozent des Haushaltseinkommens für Standardprämien bezahlen. Angesichts der aktuellen Inflation und der erneuten Prämienexplosion wird sich diese unhaltbare Situation im nächsten Jahr noch verschärfen. Der Kaufkraftverlust führt auch dazu, dass Menschen mit wenig Geld noch öfter auf Arztbesuche verzichten und so auch noch mit ihrer Gesundheit bezahlen. Das ist nicht akzeptabel.
Darum hat die SP schon 2019 die Prämien-Entlastungs-Initiative lanciert, die aktuell im Parlament behandelt wird. Sie verpflichtet Kantone und Bund, die Prämienverbilligungen so auszubauen, dass kein Haushalt mehr als 10 Prozent seines verfügbaren Einkommens für die Krankenkassenprämien bezahlen muss. Der Nationalrat hat den Handlungsbedarf erkannt und beantragt einen substanziellen Gegenvorschlag, der die Bevölkerung um Milliarden pro Jahr entlasten würde. Es liegt nun am Ständerat, die Bedürfnisse unserer Mittelschicht anzuerkennen. Tut er es nicht, wird das Volk an der Urne für Entlastung sorgen. Denn beste Gesundheit muss in der reichen Schweiz für alle erschwinglich sein.
Dieser Text ist am 26. Oktober 2022 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Wir alle stellen diese Tage besorgt fest: Die Strompreise explodieren, obwohl momentan noch keine Knappheit herrscht. Und wir haben gelernt: Der Marktpreis für Strom hat mit den Produktionskosten rein gar nichts zu tun. Er hängt nur davon ab, wie viel die Kundschaft bereit ist zu zahlen. Eigentlich verrückt für ein Gut, welches für Bevölkerung und Wirtschaft so überlebenswichtig ist. Noch absurder: Energieriese Axpo hat sich an der Strombörse verzockt und muss vom Bund gerettet werden – obwohl der Konzern der Nordostschweizer Kantone eigentlich von der Preisexplosion profitiert. Solch paradoxe Probleme brockt man sich halt ein, wenn man den Liberalisierungspropheten folgt…
Hauptgrund für diese Absurditäten ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Es sorgt dafür, dass das teuerste Kraftwerk den Preis für alle Anbieter bestimmt. Momentan bestimmt also der von Putin künstlich in die Höhe getriebene Gaspreis unsere Stromrechnung in Europa. Energieintensive Unternehmen fürchten um ihre Existenz, und Haushalte leiden unter der Preisexplosion. Zugleich rechnen die Stromproduzenten mit riesigen Extra- oder eben Übergewinnen. Gerade diejenigen, die Strom mit günstiger Wasser-, Sonnen- oder Windenergie herstellen. Fachleute sprechen von Windfall-Profiten – also von Profiten, die durch den Zufall und nicht dank unternehmerischer Entscheide entstehen.
In der Schweiz könnten in den nächsten Jahren milliardenschwere Übergewinne bei Axpo, Alpiq, BKW, Repower und Co. anfallen. Auch wenn sie aktuell in börsenbedingten Liquiditätsengpässen stecken und zumindest im Falle von Axpo eine Staatskrücke brauchen. Den bleibenden Schaden haben aber Millionen Haushalte und Zehntausende KMU. Zudem besteht die Gefahr, dass überhohe Strompreise die klimapolitisch so dringliche Dekarbonisierung bremsen.
Diese, von Putins Aggression ausgelöste und von einem dysfunktionalen Markt getriebene Strompreiskrise muss darum politisch gestoppt werden. Auch Haushalte und KMU müssen gerettet werden! Im Interesse von uns allen – und aus Solidarität mit der Ukraine. Nichts wünscht sich der Diktator im Kreml sehnlicher als sozialen Unfrieden und politische Instabilität im Westen. Genau darum dreht er Europa den Gashahn zu.
Zum Glück schlafen Brüssel und die europäischen Hauptstädte nicht. Die EU-Kommission prüft Reformen, damit Energiekonzerne mit tiefen Produktionskosten nicht mehr schwindelerregende Strompreise verrechnen dürfen. Diesen Freitag treffen sich die Energieministerinnen und Energieminister, um entsprechende Ideen zu diskutieren. Sollte sich die EU nicht schnell genug bewegen, werden verschiedene EU-Staaten wie zum Beispiel Deutschland die Übergewinne der Energiekonzerne abschöpfen, um damit Haushalte und Unternehmen zu entlasten.
Auch in Bern werden ähnliche Ideen gewälzt. Bundesrätin Simonetta Sommaruga rettet nicht nur die schlingernde Axpo. Parallel lanciert sie auch die Idee einer Übergewinn-Abschöpfung. Ob das im Gesamtbundesrat mehrheitsfähig ist? Eher nicht. Wahrscheinlicher ist, dass die Schweiz die EU-Beschlüsse nachvollziehen und wir auch in der Schweiz von diesen mitprofitieren werden. Rettet also die EU am Schluss auch unsere KMU? Gut möglich. Zu hoffen ist es allemal!
Dieser Text ist am 7. September 2022 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Bundesrat Ueli Maurer und die rechte Parlamentsmehrheit aus SVP, FDP, Mitte und GLP wollen die Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen abschaffen. Die SP hat zusammen mit den Gewerkschaften und den Grünen erfolgreich das Referendum gegen dieses Ansinnen ergriffen, weshalb wir am 25. September einmal mehr über eine unverschämte Steuervorlage der Rechten abstimmen dürfen.
Die Verrechnungssteuer ist eine sogenannte Sicherungssteuer. Ihr Zweck besteht darin, Steuerkriminalität zu verhindern. Das schreibt die Eidgenössische Steuerverwaltung auf ihrer Website klipp und klar: «Die Steuer bezweckt in erster Linie die Eindämmung der Steuerhinterziehung». Die Verrechnungssteuer stellt nämlich sicher, dass Zinserträge und Vermögen in der Steuererklärung korrekt deklariert werden. Dafür werden in einem ersten Schritt auf den entsprechenden Kapitalerträgen 35% Verrechnungssteuer abgezogen und an die Steuerverwaltung weitergeleitet. Wer die entsprechenden Vermögen in der Steuererklärung dann korrekt angibt, erhält die Verrechnungssteuer in einem zweiten Schritt wieder zurück. Dieses simple und bewährte Sicherungssystem erhöht die Steuerehrlichkeit.
Trotzdem ist die Verrechnungssteuer der Finanzplatzlobby seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Das ist nicht erstaunlich, denn die gleichen Kreise haben sich auch jahrzehntelang gegen die die Aufhebung des Bankgeheimnisses gewehrt. Sie haben eine lange Geschichte der Komplizenschaft mit ausländischen Steuerkriminellen. Auf ihre Propaganda dürfen wir im Hinblick auf die Abstimmung vom 25. September darum definitiv nicht hereinfallen.
Worum geht es bei der aktuellen Vorlage genau? Um die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationen. Zu Beginn lag eine Reform auf dem Tisch, welche die Herausgabe und den Handel mit Obligationen durch eine Abschaffung der Verrechnungssteuer attraktiver machen wollte und zugleich den Sicherungszweck mit anderen Instrumenten voll kompensieren wollte. Darüber hätte man allenfalls noch diskutieren können, wenn zugleich auch die breite Bevölkerung entlastet worden wäre.
Doch die Finanzplatzlobby wehrte sich vehement gegen eine kompromissfähige Vorlage. Anstatt den wegfallenden Sicherungszweck zu kompensieren, blockierte die Mehrheit aus SVP, FDP, Mitte und GLP unter dem Druck der Lobbyisten jede ausgewogene Idee und stimmte für eine ersatzlose Streichung der Verrechnungssteuer auf Zinsen aus inländischen Obligationen – und zwar sowohl für inländische wie auch für ausländische Anleger:innen. In letzter Sekunde hat die gleiche Mehrheit sogar noch die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf indirekten Anlagen (z.B. Obligationenfonds) hinzugefügt, was den Schlamassel noch vergrösserte.
Die Abstimmungsvorlage erleichtert also die Steuerkriminalität und führt zu massiven Steuerausfällen für die öffentliche Hand. Denn ohne Verrechnungssteuer fällt für reiche Anleger:innen ein wichtiger Anreiz weg, ihre Vermögenserträge korrekt bei der Steuererklärung anzugeben. Von der Abschaffung der Verrechnungssteuer profitieren Oligarchen, Steuerkriminelle und Grosskonzerne. Das Nachsehen hat die Bevölkerung. Der SP blieb nichts anderes übrig, als das Referendum zu ergreifen, um diesen Unsinn an der Urne zu bodigen.
Natürlich sind Steuervorlagen immer eine komplexe und trockene Materie. Aber mit diesen vier einfachen Argumenten werden wir die Mehrheit der Bevölkerung mit Sicherheit von einem Nein überzeugen können. Es wäre ein weiterer Sieg der SP gegen die finanzpolitische Unverschämtheit der rechten Parteien.
- Trotz dem überdeutlichen Volks-Nein zum Stempelsteuer-Bschiss sollen schon wieder völlig einseitig Geschenke an Konzerne und Grossanleger:innen verteilt werden. Normale Sparer:innen oder KMU gehen bei dieser Vorlage definitiv leer aus.
- Die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer reisst ohne Not ein Loch in die Bundeskasse, das am Ende von der Mittelklasse gestopft werden muss. Bei einem Ja fehlen jährlich bis zu 800 Millionen Franken. 480 Millionen davon fliessen direkt ins Ausland ab.
- Mehr Handel mit Obligationen steigert höchstens die Gewinne der Finanzbranche, führt aber nicht zu mehr Wohlstand oder neuen Arbeitsplätzen. Wir brauchen gerade in Krisenzeiten nicht mehr Spekulation, sondern eine Stützung der Kaufkraft für die breite Bevölkerung.
- Die Verrechnungssteuer hat genau einen Zweck: Steuerhinterziehung zu vermeiden. Diese Sicherung ohne Alternative zumindest bei den Obligationen abzuschaffen, belohnt Steuerkriminelle und Oligarchen. Das ist verwerflich und aus Sicht aller Steuerehrlichen einfach ein Hohn.
Dieser Beitrag ist in der Publikation der SP Graubünden ‚Concret‘ erschienen.

Charas engiadinaisas e chars engiadinais
charas Svizras e chars Svizzers
Chars conumans
Hoz es ils 1. avuost, nossa festa naziunala. A prüma ögliada nun es quai üna chosa cumplichada, anzi ella es simpla: nus festagiain nossa patria.
Für einmal gefällt mir das deutsche Wort besser als das romanische, weil es ohne patriarchale Etymologie auskommt: wir feiern nossa patria, unsere Heimat. Das ist prima vista eine einfache Sache. Doch auf den zweiten Blick gestaltet sie sich verzwickter. Dann nämlich, wenn wir uns fragen, was denn genau unsere Heimat ist. Es ist verzwickt, wenn wir versuchen diese einfache Frage ehrlich und in der Tiefe zu beantworten.
Ich versuche es trotzdem. Denn das ist sozusagen die Kernkompetenz eines Politikers: Lange Antworten auf einfache Fragen zu geben.
Also: Was ist unsere Heimat?
Eu cumainz cun l’evidaint. Nossa patria es la terra. Ob wir es wollen oder nicht. Das Schicksal hat uns diesen einen Planeten zugelost, der uns zuweilen unermesslich gross erscheint. Beispielsweise wenn wir hier oben in die Ferne blicken. Cur cha nus realisain cha davo mincha orizont daja ün oter orizont e ün oter orizont e amo ün oter orizont.
Minchatant nos planet natal ans para però eir pitschnin pitschnin. Per exaimpel cur cha nus til guardain tras il telescop da spazi James Webb. Klein scheint uns unser Planet, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie eng unsere Gesellschaften auf der Welt zusammenhängen.
Wie folgenreich ein winzig kleiner Vorfall für die globale Gemeinschaft sein kann. Beispielsweise das Überspringen eines viralen Erregers auf einen menschlichen Wirt irgendwo auf einem Markt, von dem wir hier nicht wussten, dass es ihn gibt.
Scha nus vessan dad avair invlidà malgrà la crisa dal clima o nossa economia globalisada – la pandemia ans ha trat adimanit fich bain ed in möd persistent: nus eschan üna cumünanza da destin mundiala – eine weltweite Schicksalsgemeinschaft.
Wobei, ich muss mich korrigieren: schon wieder ist mir das Wort Schicksal über die Lippen gerutscht. Dabei glaube ich nicht an die Unveränderbarkeit der Zustände. Zumindest derjenigen auf unserem Planeten. Wir haben es in der Hand, sie zu verändern. Das ist der Kern jeder demokratischen Überzeugung. Also sagen wir besser: Wir sind eine weltweite Gemeinschaft.
E cun quai cha nus eschan pertocs tuots insembel dal muond staina eir decider insembel culs listess drets e dovairs sur da la cundiziun dal muond. Eir quai es il minz da la democrazia.
Damit wird die Antwort auf die Frage, was unsere Heimat ist, ein erstes Mal erweitert: Heimat ist nicht nur geografisch zu verstehen, sondern ideell. Fragen wir uns also nicht nur: In welcher Welt sind wir zuhause? Sondern: In welchem Wert, in welchen Werten sind wir zuhause?
Cun il di da festa naziunala nu festagiana be simplamaing la Svizzra sco territori geografic plü o main casual. Nus nu festagian simplamaing ün evenimaint istoric. Nus festagiani valuors. Nus festagiain valuors democraticas.
Die Demokratie, die wir in der Schweiz feiern dürfen, ist nicht vollkommen. Bis vor etwas mehr als fünfzig Jahren hat sie die Frauen ausgeschlossen. Und noch immer, so finde ich zumindest, schliesst sie zu wenige Menschen ein, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen. Ein Viertel unserer erwachsenen, ständigen Bevölkerung darf noch nicht mitbestimmen. Ein grosses Defizit. Aber in ihrem Kern, in ihrer föderalistischen und rechtsstaatlichen Ausprägung und auch wenn man sie historisch einordnet, ist unsere Demokratie eine enorme Errungenschaft.
Sie verbindet uns mit all jenen überall auf der Welt, die sich für Freiheit, für Selbstbestimmung und für die Menschenrechte einsetzen.
Wenn wir uns in der Demokratie zuhause fühlen, haben wir eine weite Heimat, die sich über Grenzen in der Landschaft und über Grenzen in den Köpfen erstreckt. Doch dieses Zuhause, das wir alle gemeinsam und als Freie und Gleiche gestalten dürfen, ist in Gefahr. Gefährdet durch die Kriegstreiberei und den Machtanspruch der Autokraten dieser Welt. Der Krieg gegen die Ukraine, die Niederschlagung der Demokratie in Hongkong oder der Kapitolsturm in Washington am 6. Januar des letzten Jahres sind nur drei Beispiele, die uns diese Gefahr drastisch vor Augen führen.
Wo die Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit unter Beschuss geraten, erhält die Frage nach der Heimat eine ganz neue, eine brutale Dringlichkeit. Die wunderbare Heimat-Definition von alt Bundesrat Willi Ritschard, wonach Heimat da ist, wo man keine Angst zu haben braucht, wird für zu viele Menschen auf der Welt in Frage gestellt.
Ils fügitivs da l’Ucraina, da l’Afghanistan, da la Siria o da l’Eritrea ans pon quintar tristas istorgias da lur patria. E per nus, cha nus vain il privilegi da viver sainza temma stoja per quai esser cler: scha nossa patria es la democrazia ed il stadi da dret, lura es ella eir gronda avonda per quels chi tscherchan refügi, protecziun e perspectivas.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich in Europa die Erkenntnis durchgesetzt, dass einzelne, sich konkurrierende oder sogar bekämpfende Nationalstaaten oder Imperien keine Garanten für Frieden, Wohlstand und Fortschritt sind.
Gemeinsame Regeln, Zusammenarbeit und europäische Integration sind es hingegen. La Cumünanza europeica e plü tard l’Uniun han svilpà inavant l’idea da stadi da dret e da democrazia.
Die europäische Integration hat den Heimatbegriff vieler Europäerinnen und Europäer erweitert. Und weil diese Einigung eben eine Absage an imperiale Alleingänge und autokratische Gelüste ist, ist sie den Diktatoren wie Putin oder Lukaschenko ein so grosser Dorn im Auge.
Was ist unsere Heimat?
Selbstverständlich das gemeinsame, demokratische Europa.
Nus fain festa quia a Scuol sülla Motta Naluns. Quia es nos vaschinadi ed eir nos spiert europeic evidaint. Be pacs cumüns pon pretender dad avair duos vaschins europeics. No sperain e lavurain insembel cun blers ingaschats per cha ün bel di quist vaschinadi sia eir colià cun ün tren direct. Scuol-Mals füss üna bella ouvra engiadinaisa ed europeica!
Dass ich Europa selbstverständlich als Heimat verstehe, hat auch mit meiner persönlichen Geschichte und mit der Geschichte meiner Familie zu tun. Ich bin Doppelbürger. Neben der schweizerischen habe ich auch die italienische Staatsbürgerschaft. Meine Mutter ist in Rom und Florenz aufgewachsen. Meine Grosseltern und Urgrosseltern auf der italienischen Seite habe die zwei Weltkriege direkt erlebt, den europäischen Albtraum, in den uns Nationalismus und Faschismus getrieben haben. Nur wenige Kilometer von hier entfernt im Südtirol finden wir noch immer die Soldatengräber des Ersten Weltkriegs.
L’Europa nun es ün «Moloch» bürocratic. L’Europa es la pasch e la democrazia. Europa ist kein Suprastaat, der uns persönliche Freiheiten raubt. Europa und die Europäische Union sind das Resultat der wichtigsten Lektion der Geschichte: Dass unsere Heimat nur Bestand hat, wenn sie mit anderen Heimaten kompatibel ist.
La Svizra fa part da quista Europa. Istoricamaing, culturalmaing ed eir politicamaing. Cun ils contrats bilaterals faina part dal proget d’integraziun da l’Europa. Nus vain per exaimpel ingrondì nossa patria cun la libra circulaziun da persunas. E quai a nos avantatg! Noss ospidals, nos hotels e restorants, nossas uffizinas e nos plazzals da fabrica, nossas chasas da chüra e bler oter nu funcziuness sainza l’integraziun europeica e sainza la libra circulaziun.
Doch dieser so genannte «bilaterale Weg» ist eine Lösung auf Zeit. Und nun stösst er an seine strukturellen Grenzen. Weshalb?
Zentral für das Zustandekommen der Bilateralen Verträge war die Erwartung auch der EU, dass der schrittweise Beitritt zum Binnenmarkt den Weg zur Vollmitgliedschaft der Schweiz ebnen würde. Spätestens mit dem Rückzug des Beitrittsgesuchs gibt es diese Perspektive nicht mehr. Die EU sieht seither die Einheitlichkeit ihres EU-Rechts durch Sonderverträge mit der Schweiz gefährdet. Dann kommt der Fakt hinzu, dass die Schweiz seit der EU-Osterweiterung mit fast doppelt so vielen Mitgliedern verhandeln muss wie zuvor. Mit Mitgliedern notabene, denen in den Verhandlungen über ihren EU-Beitritt keinerlei Ausnahmen gewährt wurden. Das verringert die Akzeptanz für eine Schweizer Sonderlösung. Und mit dem Brexit verschlechterte sich die Verhandlungsposition der Schweiz noch weiter.
Was ist unsere Heimat?
Natürlich lautet eine Antwort darauf, besonders am 1. August: Die Schweiz ist unsere Heimat! Wir tun gut daran, diese nicht kleiner zu machen, als sie ist. Wir sollten ihr einen guten Platz im europäischen Netz der Heimaten sichern. Was es jetzt braucht, ist eine klare Strategie hin zu einer institutionellen Zusammenarbeit.
Kurzfristig ein Stabilisierungsabkommen, das unter anderem die gefährdete Teilnahme an den europäischen Forschungs- und Bildungsprogrammen sichert. Mittelfristig braucht es eine Assoziierung mit der EU. Das heisst, wir müssen die vielen einzelnen sondervertraglichen Lösungen auf ein einziges tragfähiges Wirtschafts- und Kooperationsabkommen vereinen.
Und ja, langfristig müssen wir uns vorurteilsfrei und sachlich über einen EU-Beitritt unterhalten. Europa entwickelt sich weiter. Die Schweiz hätte dazu viel beizutragen. Abseits zu stehen und unfreiwillig Gesetze nachzuvollziehen, schleichend den Zugang zum Binnenmarkt und persönlichen Freiheiten zu verlieren, ist eine schlechte Option. Sie geht wieder mehr in Richtung der letztlich undemokratischen Schicksalsergebenheit statt der Selbstbestimmung.
So, nun habe ich in Bezug auf die Heimat vor allem über die grossen geo- bis europapolitischen Zusammenhänge gesprochen. Und ich kann es niemandem verübeln, der sagt: Moment, Heimat ist doch viel intimer. Heimat ist regional, lokal, familiär. Das stimmt. Denn Heimat ist eben vielschichtig. Verankerung ist wichtig.
Il Grischun es mia patria. Sia cultura multifara. Sias trais linguas e ses blers idimos e dialects sun mia patria. Sia cultura e sia natüra sun mia patria. Üna patria ch’eu vögl proteger e chürar. Proteger nossa natüra ed il clima sun ün act patriotic! Avair jent nossa cultura e dovrar nossa lingua sun acts d’amur per nossa cumünanza.
Das Unterengadin ist meine Heimat. Ich könnte über meine Verankerung hier noch viele schöne Worte verlieren. Doch Pathos habt ihr in meiner Rede schon genug gehört. Zum Schluss möchte ich noch auf eine sehr dringliche Frage rund um die Heimat zu sprechen kommen. Eine Frage, die sich hier im Unterengadin besonders stellt.
Was tun, wenn sich Menschen ihre Heimat nicht mehr leisten können?
Die Verdrängungseffekte durch den Zweitwohnungsbau und die Immobilienspekulation führen dazu, dass es für die arbeitende Bevölkerung im Unterengadin immer schwieriger wird, sich das Wohnen zu leisten. Einstmals belebte Dorfkerne verlieren ihre Lebendigkeit und ihre soziale Funktion. Orte der Gemeinschaft verschwinden. Das Ausweichen auf die grüne Wiese ist keine Option. Auch die Bündner Bevölkerung hat – zu Recht – Ja gesagt zu einem Raumplanungsgesetz, dass schonend mit der endlichen Ressource des Bodens umgeht. Doch nun drohen hier im Tal Abwanderung und reine Kulissendörfer.
Was tun dagegen? Klar, die Politik ist gefordert. Die Gemeinden müssen aktiv Wohnbaupolitik und Raumplanung betreiben. Und auch der nationale Gesetzgeber könnte aktiv werden. Ein paar Ideen hätte ich.
Doch es ist besser, wenn der dringende Aufruf nicht von einem Nationalrat kommt, sondern wenn die Bevölkerung das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt. So wie es hier im Unterengadin die Società Anna Florin macht. Ich erlaube mir, kurz von ihrer Webseite zu zitieren:
«La società sustegna als cumüns in lur lezchas resultadas tras las fusiuns e tils motivescha da far frunt al marchà d’immobiglias da seguondas abitaziuns. Lös d’inscunter pella populaziun dessan gnir mantgnüts e nouvs dessan gnir creats. Anna Florin sensibilisescha a las abitantas ed als abitants dals cumüns sco eir a las possessuras ed als possessurs da seguondas abitaziuns pellas pussibiltats d’üna cumünanza viva ed animescha da chürar il plaschair da viver in Engiadina Bassa.»
Und weil es so wichtig ist auch noch auf Deutsch. Der Verein Anna Florin:
«(…) ermutigt und unterstützt die Gemeinden, den Konsequenzen von Gemeindefusionen und dem Druck des Zweitwohnungs-Immobilienmarkts entgegenzuwirken, bestehende Räume für die Dorfgemeinschaften zu bewahren und Neue zu fördern. Anna Florin sensibilisiert die Bewohner:innen und die Zweitwohnungsbesitzer:innen für die Möglichkeiten einer vitalen Gemeinschaft und animiert sie dazu sich aktiv und nachhaltig für die Lebensqualität im Unterengadin einzubringen.»
Ich finde das eine sehr wichtige Sache und lege allen, die sich für das Unterengadin engagieren möchten, eine Mitgliedschaft bei Anna Florin nahe. Auf die Frage «Was ist unsere Heimat?» liefert Anna Florin nämlich die überzeugendste Antwort überhaupt.
Unsere Heimat ist, was wir aus unserer Heimat machen.
Nossa patria es quai cha nus fain landroura.
Grazcha fichun per vossa attenziun e bun 1. avuost a nus tuots!

Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine tobt seit über vier Monaten. Tausende wurden getötet, ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets ist besetzt, Millionen mussten fliehen, Grossstädte sind zerstört und die schrecklichen Bilder der Kriegsverbrechen lassen uns nicht mehr los. Verbrecherisch ist auch Putins Blockierung der Agrarexporte, die zu Hunger und Elend in vielen afrikanischen Staaten führen könnten.
Gleichzeitig drohen wir in Westeuropa den Fokus zu verlieren. Unsere Angst vor einem Mangel an Gas und Strom oder vor der Inflation dominieren die heimische Debatte – und nicht mehr die Solidarität mit der Ukraine. Die Sorgen um Versorgungssicherheit und Kaufkraft sind berechtigt, dürfen uns aber nicht dazu verleiten, den Ausweg in einem Kniefall vor dem Aggressor zu suchen.
Genau dieser Versuchung erliegt SVP-Vizepräsidentin Magdalena Martullo-Blocher. In einem NZZ-Interview fordert sie, Europa müsse jetzt mit dem russischen Diktator in Verhandlungen treten, um russische Gaslieferungen zu sichern und die Kampfhandlungen zu beenden. Über das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine verliert sie kein Wort. Ein faktischer Diktat-Frieden, den Europa über die Köpfe der ukrainischen Bevölkerung hinweg mit Putin verhandeln würde, wäre aber eine politische Kapitulation Europas. Und eine Bankrotterklärung für unsere Werte. Putin wüsste, dass Europa mit Waffengewalt erpresst werden kann. Diesen Gefallen dürfen wir dem Gewaltherrscher im Kreml nicht machen. Treffend disqualifiziert die bürgerliche NZZ daher diese defätistische SVP-Haltung: «Dass ausgerechnet die SVP, die sich stolz-patriotisch gibt, eine geschichtsvergessene Sicherheitspolitik betreibt, auf Appeasement gegenüber einem Diktator setzt und den Freiheitswillen des ukrainischen Volkes als vernachlässigbar behandelt, ist beschämend.»
So ist es. Putins illegaler und imperialistischer Krieg darf nicht belohnt werden. Darum bleibt Europa und auch der Schweiz nichts anderes übrig, als geeint die Ukraine zu unterstützen. Putin muss politisch isoliert und seine Wirtschaft mit Sanktionen geschwächt werden. Zugleich muss der Bundesrat im Verbund mit Europa alles tun, um Energiemangellagen sowie wirtschaftliche und soziale Verwerfungen zu verhindern. Wir müssen im Hinblick auf nächsten Winter Energie sparen und die Kaufkraft der Menschen sichern. Beides ist mach- und zumutbar. Persönliche Beiträge wie kürzeres Duschen, Standby-Modus abschalten oder die Zimmertemperatur auf «nur» 20 Grad einstellen, sind im Falle einer Mangellage nicht zu viel verlangt. Und öffentliche Investitionen in mehr Krankenkassenverbilligung, einem Teuerungsausgleich bei AHV- und IV-Renten sowie einem «chèque fédéral» zur Unterstützung der Familien können wir uns als sehr reiches Land mit minimaler Verschuldung locker leisten. Nicht vergessen dürfen wir auch unsere humanitären Verpflichtungen gegenüber den Ländern Afrikas, denen eine Ernährungskrise droht. Über den nächsten Winter hinaus müssen wir uns mit massiven Investitionen in erneuerbare Energien von unserer Energieabhängigkeit befreien und möglichst schnell Verkehr, Wohnen und Wirtschaft dekarbonisieren.
Nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war europäischer Zusammenhalt so wichtig – und so offensichtlich auch im Interesse der Schweiz. Unsere Sicherheit ist nur in einem europäischen Zusammenhang möglich. Unsere internationale Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit des Schweizer Rechtsstaats sterben, wenn wir angesichts von Putins Kriegsverbrechen auf Appeasement setzen. Gerade im Namen unserer aktiven Neutralität müssen wir Partei ergreifen: Für die Stärke des Rechts und gegen das Recht des Stärkeren.
Für die Ukraine, für ein freies und sicheres Europa und für unsere Glaubwürdigkeit als Schweiz brauchen wir mehr und nicht weniger europäischen Zusammenhalt. Was wir definitiv nicht brauchen, ist ein Bückling vor dem Aggressor.
Dieser Text ist am 1. Juli 2022 als Gastkommentar in der Zeitung Bündner Tagblatt erschienen.

Die grösste ungeklärte Frage der «Berner Politik» ist unser Verhältnis zu Europa. Spätestens seit dem bundesrätlichen Verhandlungsabbruch zum Rahmenabkommen vor einem Jahr befindet sich die helvetische Politik diesbezüglich in einem gefährlichen Blindflug. Dabei spüren die Bürgerinnen und Bürger gerade in dieser Krisenzeit, wie wichtig Zusammenarbeit und Zusammenhalt in Europa auch für uns Schweizerinnen und Schweizer sind.
Putins verbrecherische Aggression gegen die Ukraine ist auch ein Angriff auf unsere gemeinsamen europäischen Werte. Umso wichtiger war und ist die gemeinsame Antwort Europas, der sich nach anfänglichem Zögern auch die Schweiz angeschlossen hat. Aber nicht nur Putins Krieg hat die geopolitische Lage fundamental verändert. Auch der Aufstieg des autokratischen China und die seit Trump offensichtlich gewordene Verletzlichkeit der US-Demokratie stellen riesige Herausforderungen dar, die von unseren europäischen Demokratien nur vereinigt gemeistert werden können. Und auch Menschheitsprobleme wie die Klimakrise, die Ungleichheit oder die Übermacht der Konzerne erfordern europäische Lösungen.
Vor diesem Hintergrund durfte ich in den letzten Monaten eine SP-Arbeitsgruppe leiten, die eine europapolitische Strategie entwickelt hat. Dieser unlängst publizierte Europa-Plan sieht drei Phasen vor.
Erstens: Die Verhandlung eines befristeten Stabilisierungsabkommens mit der EU, das die Schweizer Teilnahme an verschiedenen EU-Programmen in den Bereichen Forschung, Bildung oder Kultur regelt (Erasmus, Horizon, etc.). Im Gegenzug verpflichtet sich die Schweiz ihren Beitrag für die Beseitigung wirtschaftlicher Ungleichheiten zu erhöhen und die Verhandlungen über die Regeln zur Teilnahme am EU-Binnenmarkt wieder aufzunehmen. Ein solches Abkommen sollte bis Ende 2023 vorliegen. Am 13. Juni stimmt der Nationalrat über einen Vorschlag der Aussenpolitischen Kommission ab, die den Bundesrat zu genau diesem Schritt verpflichten will.
Zweitens: Die Verhandlung eines Wirtschaftsabkommens, das die institutionellen Marktzugangsfragen im Sinne einer Assoziierung regelt. Dieses Abkommen sollte bis 2027 stehen, was im Sinne einer Garantie gegenüber der EU so auch im Stabilisierungsabkommen zu vereinbaren ist. Für die innenpolitische Abstützung und Legitimation dieses Assoziierungsprozesses sollen dessen Rahmenbedingungen in einem Europagesetz geregelt werden. Einer entsprechenden parlamentarischen Initiative aus der SP-Küche hat der Nationalrat an der letzten Session bereits zugestimmt. Nun liegt der Ball beim Ständerat.
Drittens: Ab 2027 will die SP auf Basis des vorher geregelten Verhältnisses mit der EU ergebnisoffen über den Beitritt der Schweiz verhandeln. So könnte unser Land endlich dort mitbestimmen, wo die Politik in und für Europa im 21. Jahrhundert entschieden wird. Echte Souveränität gibt es heute nämlich nur mit internationaler Mitbestimmung, wobei die EU die wichtigste Plattform in Europa bietet. Nur sie schafft die Möglichkeit, dass unsere kleinen europäischen Demokratien nicht von Supermächten oder Grosskonzernen gegeneinander ausgespielt werden. Nur die EU hält unseren Kontinent zusammen und unsere gemeinsamen Werte hoch!
Dieser Text ist am 1. Juni 2022 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Peter Peyer hat eine unter Politikern seltene Charaktereigenschaft: in der Sache ist er ambitioniert, persönlich aber äusserst bescheiden. Das ermöglicht ihm, Politik wirklich für das Gemeinwohl zu machen. Als Regierungsrat und Gesundheitsdirektor ist er sich diesbezüglich treu geblieben. Auch darum wurde Graubünden zum allseits gelobten Pionierkanton in der Pandemiebekämpfung. Peter Peyer hat eine glanzvolle Widerwahl verdient – Graubünden wird dadurch nur gewinnen.
Il Grischun profita cun Peyer
Peter Peyer ha ün trat da caracter rar tanter politikers: el es ambizius illa lavur politica, ma sco persuna e’l ourdvart modest. Quai til permetta da lavurar veritabelmaing per il bainstar public. Sco cusglier guvernativ e minister da la sandà e’l restà fidel a sai svess. Quai es üna da las radschuns cha’l Grischun es stat ün chantun pionier lodà dapertuot i’l cumbat cunter la pandemia. Peter Peyer merita üna reelecziun excellenta – il Grischun profitarà da quella.
Peyer porta in alto i Grigioni
Peter Peyer ha un tratto caratteriale raro tra i politici: è ambizioso nel lavoro politico, ma a livello personale è estremamente modesto. Ciò gli permette di lavorare veramente per il bene comune. Anche come Consigliere di Stato e ministro della salute è rimasto fedele a se stesso. Questa è una delle ragioni per cui i Grigioni sono diventati un cantone pioniere lodato da tutte e tutti nella lotta contro la pandemia. Peter Peyer merita una rielezione brillante – saranno i Grigioni a guadagnarne.

Im Jahr 2021 standen 1434 Personen auf der Warteliste für eine Organspende. Pro Woche sterben ein bis zwei Menschen, während sie auf ein Organ warten. Dass man selbst oder ein Familienmitglied auf ein Spendenorgan angewiesen sein könnte, ist rund sechs Mal wahrscheinlicher, als dass man seine Organe spenden kann. Das Problem: Es haben sich schlicht zu wenige Menschen ins Organspendenregister eingetragen. Gleichzeitig zeigen Umfragen, dass 80% der Bevölkerung die Organspende eigentlich befürworten.
All dies zeigt, warum es eine Änderung des Transplantationsgesetz braucht. Die zur Abstimmung stehende Vorlage will bei der Organspende die heutige Zustimmungslösung durch eine erweiterte Widerspruchslösung ersetzen. Wie in vielen Ländern Europas. Die Organspende bleibt selbstverständlich freiwillig. Wer seine Organe nicht spenden möchte, kann dies festhalten oder seinen Angehörigen mitteilen. Es werden aber mehr eigentlich Spendenwillige im Todesfall auch zu Spenderinnen oder Spendern. Damit retten sie Leben. Ein Ja am 15. Mai ermöglicht das.
Dieser Text ist im Concret, dem Publikationsorgan der SP Graubünden, erschienen.

Wenn amerikanische Internet-Giganten wie Disney+ oder Netflix Serien und Filme in der Schweiz zeigen und damit sehr viel Geld verdienen, sollen sie in Zukunft 4% ihrer Einnahmen hier investieren. Das gleiche würde für ausländische Werbefenster gelten. Darum geht es im neuen Filmgesetz, über das wir am 15. Mai abstimmen.
Das Gesetz schafft eine Ungerechtigkeit ab. Denn Schweizer Fernsehsender sind schon heute verpflichtet, 4% ihrer Einnahmen in Schweizer Filme und Serien zu investieren. Da darf es doch nicht sein, dass ausländische Grosskonzerne in unserem Land besser fahren als einheimische Sender. Nur schon darum braucht es ein Ja am 15. Mai.
Die Einnahmen der hochrentablen Streaminganbieter fliessen heute fast vollständig ins Ausland ab. Mit dem neuen Filmgesetz würde zumindest ein Teil in der Schweiz reinvestiert. Entgegen der Behauptung der ideologisch verbohrten Gegner gibt es keine «Filmsteuer». Netflix und Co. müssten einfach Schweizer Serien und Filme produzieren. Eine Ersatzabgabe für die Konzerne fiele nur an, wenn sich diese weigern würden, Schweizer Produktionen zu realisieren. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Das neue Filmgesetz bringt damit mehr Schweiz auf die Bildschirme und ermöglicht mehr Filmstoff, der nah an unserer Lebensrealität ist. Das stärkt unser Filmschaffen, unsere Kultur und unsere Identität. Und es schafft hier Arbeitsplätze – ganz ohne zusätzliches Steuergeld. Es wäre eine Dummheit, diese Gelegenheit auszuschlagen.
Die meisten europäischen Länder kennen bereits Investitionspflichten oder Ersatzabgaben für internationale Streaminganbieter. Die Schweiz braucht gleich lange Spiesse, soll sie bei internationalen Produktionen weiterhin berücksichtigt werden. Auch darum brauchen wir ein Ja zum Filmgesetz.
Dieser Text ist als Meinungsbeitrag in der Südostschweiz erschienen.

Putins Krieg gegen die Ukraine tobt seit 49 Tagen. Die humanitäre Katastrophe verschärft sich. Tausende werden getötet, Millionen müssen fliehen, Grossstädte wie Mariupol sind komplett zerstört und die Bilder brutalster Kriegsverbrechen verstören uns alle.
Weil der Diktator Putin unverhohlen mit seinen Atomwaffen droht, haben vielen Menschen in ganz Europa verständlicherweise Angst. Davon dürfen wir uns nicht lähmen lassen. Als Demokratinnen und Demokraten müssen wir und unsere Regierungen das Richtige tun.
Das Richtige für die Schweiz sind humanitäre Hilfe und eine würdige Aufnahme der Flüchtenden. Und: eine konsequente Umsetzung und Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Moskau. Seit Jahrzehnten verhängt die Schweiz bei Völkerrechtsverletzungen Sanktionen – zum Beispiel nach dem Einmarsch von Saddam Hussein in Kuwait 1990. Sie widersprechen also nicht der Schweizer Neutralität.
Wirtschaftssanktionen gegen das Putin-Regime bestrafen seinen Völkerrechtsbruch und erschweren ihm die Finanzierung des Kriegs. Wichtige zusätzliche Sanktionen der Schweiz sind darum ein Verbot des Handels fossiler Energien aus Russland auf Schweizer Handelsplätzen und ein möglichst rascher Ausstieg aus russischem Öl und Gas. Das muss der Bundesrat jetzt tun.
Die Sanktionen sind aber auch eine Frage der Gerechtigkeit, des europäischen Zusammenhalts – und sie sind in unserem Interesse als Schweiz. Unsere Sicherheit ist nur in einem europäischen Zusammenhang möglich. Unsere internationale Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit des Schweizer Rechtsstaats sterben, wenn wir angesichts von Putins Kriegsverbrechen im Abseits stehen. Gerade im Namen unserer aktiven Neutralität müssen wir Partei ergreifen: Für die Stärke des Rechts und gegen das Recht des Stärkeren. Die Schweiz muss Anwältin des Völkerrechts sein.
Die Schweiz ist heute eine intransparente Drehscheibe für Finanz- und Handelstransaktionen. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Putins Russland 2014 dienten sich Rohstoffhändler aus Zug und Genf russischen Oligarchen und Staatsunternehmen geradezu offensiv an. Auch haben wir immer noch ein viel zu lasches Geldwäschereigesetz, das internationale Standards missachtet. Es greift zum Beispiel nicht für das Anwaltswesen, die Immobilienwirtschaft und den Kunsthandel. Und wir brauchen endlich und dringend ein Register der wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Nur so können wir die Vermögenswerte der international sanktionierten Oligarchen und Organisationen aufspüren.
Kurz: Wir müssen unsere Gesetze griffiger machen. Unser Finanz- und Rohstoffhandelsplatz brauchen endlich ein sauberes Geschäftsmodell mit der nötigen Transparenz. Für die Ukraine. Für ein freies Europa. Für die Zukunft der Schweiz.
Dieser Text ist am 13. April 2022 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Chur, 31. März 2022
Sehr geehrte Frau Kollegin, liebe Magdalena
Auf dem Höhepunkt der Pandemie hast du in dieser Zeitung dem Bundesrat vorgeworfen, dass er in der Schweiz eine Diktatur eingeführt habe. Für diesen abstrusen Angriff auf unsere Demokratie hast du dich bis heute nie entschuldigt.
Nun lesen wir, dass du deinen Mitarbeitenden in der Ems Chemie verbietest, Putins Krieg gegen die Ukraine einen Krieg zu nennen. Dasselbe verbietet Putin in Russland. Und letzten Samstag hast du in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger gesagt, «auf Putin einzuprügeln» verschärfe nur den Konflikt – auch er müsse «einen Erfolg vorweisen können».
Echt jetzt? Krieg dürfen wir nicht Krieg nennen und dem brutalen Diktator müssen wir einen Erfolg gönnen?
Du führst ein Milliardenunternehmen mit Erfolg und du bist die bestgewählte Bündner Nationalrätin. Dafür gebührt dir Respekt. Aber ich frage mich, ob du die Grundlagen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verstehst. Das bereitet mir und vielen Menschen Sorge.
Nachdenkliche Grüsse
Jon Pult, Nationalrat

In Davos forschen Wissenschaftler:innen des Weltstrahlungszentrums der ETH oder des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung. Unsere Fachhochschule in Chur bietet mit Informationswissenschaften und Multimedia Production zwei schweizweit einmalige Studiengänge an. Das weiss die interessierte Schweiz. Und das nimmt auch Bundesbern wahr.
Ein guter Bündner Forschungsplatz bleibt in Zukunft aber nicht einfach so gut. Es braucht dafür mehr Investitionen und mehr Stipendien. Für beides muss die Politik sorgen. Denn ein attraktiver Forschungsplatz erlaubt es Graubünden, die Zukunft zu gestalten. Für die Bündner Volkswirtschaft ist der Forschungsstandort Graubünden essenziell. Ohne Bildung an guten Hochschulen fehlen Fachkräfte. Und ohne Fachkräfte gibt es keinen Fortschritt. Gleichzeitig sind Forschung und Bildung viel mehr als ein ökonomischer Wert. Bildung und Forschung befähigen zum Hinterfragen von Gewissheiten und zum Engagement für das Gemeinwohl. Bildung und Forschung schaffen also auch mündige Staatsbürger:innen.
All das funktioniert jedoch nur, wenn wir gute Beziehungen zu Europa pflegen. Eine bildungspolitisch isolierte Schweiz kann langfristig keine Heimat für renommierte Institutionen wie das Weltstrahlungszentrum sein. Der Verhandlungsabbruch beim Rahmenabkommen ist darum die zentrale politische Herausforderung für den Forschungsplatz Schweiz und damit auch für den Forschungsplatz Graubünden. Der Bündner Forschungsplatz braucht Europa. Ohne Europa gibt es auch in Graubünden keinen Fortschritt.
Der Text ist in der Sonderbeilage «Bilden & Forschen» in Graubünden vom 16. März 2022 erschienen.

Was passiert mit Kunstwerken, die jüdischen und anderen von den Nazis verfolgten Menschen zwischen 1933 und 1945 geraubt wurden oder auf der Flucht unfreiwillig verkauft werden mussten? Welche Verantwortung trägt die neutrale Schweiz, die während des Zweiten Weltkrieges ein wichtiger Umschlagplatz für Kunstgüter war? Was machen wir mit Kulturgütern, die im Kontext der kolonialen Ausbeutung in unser Land gelangten? Wie gehen wir mit dem historischen Unrecht in unserem kulturellen Erbe um? Wie wollen wir heute Gerechtigkeit herstellen für so lange zurückliegendes Unrecht?
Das erinnerungspolitische Debakel um die Kunstsammlung des Waffenhändlers Emil G. Bührle im Zürcher Kunsthaus hat diese Fragen in den Fokus gerückt. Nicht nur, weil Zürichs Institutionen und Eliten eine schlechte Falle im Umgang mit der Geschichte «ihrer» Kunst machen und darum von der internationalen Presse blossgestellt werden. Das Bührle-Debakel hat auch ein langjähriges Versäumnis unseres Landes offengelegt. Es fehlen uns zweckmässige Instrumente für den Umgang mit Kulturgütern, die in Kontexten historischen Unrechts wie dem Faschismus oder dem Kolonialismus die Hand wechselten.
Darum habe ich im vergangenen Dezember zusammen mit 34 Kolleginnen und Kollegen aus allen Parteien eine Motion eingereicht, die den Bundesrat beauftragt, eine unabhängige Fachkommission einzusetzen. Diese soll für Kunstwerke, die im Zusammenhang mit der Nazi-Diktatur die Hand wechselten und deren Besitzansprüche ungeklärt sind, «gerechte und faire» Lösungen im Sinne der internationalen Verpflichtungen der Schweiz suchen. So wie dies in den Washingtoner Prinzipien von 1998 und der Erklärung von Theresienstadt von 2009 verankert ist. Im Streitfall würde die Kommission die Fakten aufarbeiten und eine fachlich fundierte Empfehlung abgeben. Vergleichbare Kommissionen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Grossbritannien und in den Niederlanden haben sich bewährt und konnten neben der Lösung konkreter Fälle auch zu einer Verbesserung der Erinnerungskultur beigetragen. Der Bundesrat soll auch prüfen, ob Kulturgüter aus kolonialen Kontexten ebenfalls zum Aufgabenfeld der Kommission gehören sollten.
Letzte Woche gab der Bundesrat bekannt, dass er mit der Einsetzung einer Kommission grundsätzlich einverstanden ist. Es brauche gerechte und faire Lösungen bei Kulturgüterstreitigkeiten – sowohl bei Nazi-Raubkunst als auch bei Kulturgütern aus einem kolonialen Kontext. Diese Zustimmung ist eine Premiere in der Schweiz und ein politischer Durchbruch. Der nächste Schritt muss sein, die Kommission gemäss den in meinem Antrag skizzierten Rahmenbedingungen bald einzurichten.
Endlich scheint unsere Regierung bereit, die von der Schweiz angenommenen internationalen Grundsätze der historischen Verantwortung im Umgang mit Kulturgütern konkret umzusetzen und nicht länger hinter dem Einsatz anderer Staaten zurückzustehen. Die kultur- und aussenpolitische Glaubwürdigkeit der Schweiz würde so gestärkt. Hoffentlich packen National- und Ständerat die Chance und überweisen diese Motion. Um Gerechtigkeit herzustellen – heute!
Dieser Text ist am 23. Februar 2022 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Für unsere Demokratie ist unabhängige Berichterstattung in allen Regionen überlebenswichtig. Darum müssen wir die Medien unterstützen, wenn sie sich allein nicht mehr finanzieren können. Denn Journalismus kann man nicht einfach wie andere Tätigkeiten in Billiglohnländer verschieben. Nicht umsonst nennt man die Medien auch «vierte Staatsgewalt».
Regionale Medien sind systemrelevant
Klar, um über das Weltgeschehen informiert zu sein, bräuchten wir nicht mehr viele Schweizer Medien. Internationale Titel und globale News-Portale, die wir praktisch über das Internet abrufen können, decken unseren Informationsbedarf ab. Aber um lokale, kantonale oder nationale Informationen zu erhalten und um die Zusammenhänge unseres Landes und unseres unmittelbaren Lebensumfelds zu verstehen, brauchen wir Redaktionen und Publikationen vor Ort – und zwar flächendeckend. Ein wichtiger Teil dieses medialen Service Public deckt die SRG ab. Zusätzlich braucht es aber auch private Medienhäuser, die aus unterschiedlichen Warten die Bevölkerung über das lokale Leben informieren und sie für wichtige Debatten rüsten. Für ein viersprachiges, föderalistisches und direktdemokratisches Land wie die Schweiz sind neben der SRG gerade regionale Medien schlicht systemrelevant.
Journalismus in der Krise
Heute leiden der Journalismus und die Medienvielfalt auch in unserem Land erheblich. Rund 70 Zeitungstitel sind schon verschwunden, die verbleibenden Zeitungen werden dünner, die Redaktionen werden kleiner und immer mehr Titel und Sender kämpfen ums Überleben. Der Hauptgrund sind die wegfallenden Werbeeinnahmen, mit denen sich der Journalismus bisher finanzierte. In rund zehn Jahren haben sich die Werbeeinnahmen der Schweizer Medien mehr als halbiert!
Dieser Rückgang liegt nicht etwa daran, dass heute weniger Werbung geschaltet würde. Im Gegenteil. Die Werbegelder fliessen reichlich, einfach zu einem wachsenden Teil nach Kalifornien zu den Tech-Giganten wie Google und Facebook. Das Kuchenstück für die Schweizer Medien wird hingegen immer kleiner. Die gefährliche Folge dieses Strukturwandels ist Medienkonzentration beim Inhalt, aber auch bei den Besitzverhältnissen. Beides ist schädlich für die Demokratie und schreitet auch in der Schweiz voran. Natürlich: In Nischen entstehen neue, ermutigende Online-Projekte. Doch insgesamt ist der Trend negativ.
Rechtspopulisten als Krisengewinnler
Von der Medienkrise versuchen in vielen Ländern Rechtspopulisten zu profitieren, indem sie oder ihre Financiers Medien aufkaufen, die sie dann als Propagandainstrumente einsetzen. In der Schweiz stecken diese Kreise auch hinter dem Referendum gegen das Massnahmenpaket zugunsten der Medien, das am 13. Februar zur Abstimmung kommt. Die Weltwoche, der Nebelspalter und das Gratismedien-Imperium von Christoph Blocher könnten also nur der Vorgeschmack sein, wenn die Bevölkerung nicht Gegensteuer gibt.
Das Medienpaket hilft
Das Parlament hat das ausgewogene Medienpaket von Bundesrätin Simonetta Sommaruga über ein Jahr lang beraten. Es brauchte unzählige Kommissionssitzungen, eine Rückweisung der Vorlage an die Kommission durch den Nationalrat, drei Differenzbereinigungen zwischen den Räten und eine Einigungskonferenz, bis wir nach vielen Tricks und Kompromissen am Ziel waren. Zur Abstimmung stehen folgende Massnahmen:
- Erhöhung der Unterstützung für Nachrichtenagenturen, mediale IT-Projekte, Branchenorganisationen (Presserat etc.) sowie Aus- und Weiterbildung für Journalist:innen um 23 Millionen auf insgesamt 28 Millionen Franken. Diese unbefristete Erhöhung der Fördermittel für alle Medien stammt aus der Radio- und Fernsehabgabe und belastet die Bundeskasse nicht.
- Erhöhung der Unterstützung für private Radio- und TV-Stationen um jährlich maximal 28 Millionen auf insgesamt maximal 109 Millionen Franken. Diese Erhöhung der Förderung ist ebenfalls unbefristet und stammt ebenso aus der Radio- und Fernsehabgabe.
- Erhöhung der Vergünstigung der Postzustellung von abonnierten Zeitungen und Zeitschriften von heute 30 auf neu 50 Millionen Franken sowie der Vereins- und Stiftungspresse von heute 20 auf 30 Millionen Franken pro Jahr. Neu wir auch eine jährliche Vergünstigung der Früh- und Sonntagszustellung von Zeitungen im Umfang von 40 Millionen Franken eingeführt. Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben dieser seit 1849 bestehenden indirekten Presseförderung von heute 50 auf neu 120 Millionen Franken. Diese Erhöhung ist auf sieben Jahre befristet und wird aus der Bundeskasse bestritten.
- Neue Förderung von Online-Medien mit jährlich 30 Millionen Franken, wobei kleinere Online-Medien proportional deutlich stärker gefördert werden als grössere. Als Bemessungsgrundlage dienen die Einnahmen aus Abonnements, Mitgliedschaften, Tagespässen oder andere Beiträge der Leser:innenschaft. Mit der Förderung ist wie bei der Zustellvergünstigung kein direkter Leistungsauftrag verbunden, was die Unabhängigkeit sichert. Auch diese neue Förderung ist auf sieben Jahre befristet und wird aus der Bundeskasse bestritten.
All das ist dringend nötig, wenn wir verhindern wollen, dass die vierte Staatsgewalt erodiert oder den Rechtspopulisten in die Hände fällt. Und es ist dringend nötig, wenn wir wollen, dass die Bevölkerung auch in Zukunft unabhängige Zeitungen, Radios, TV-Stationen und Online-Portale hat, die über ihre Region, ihre Gemeinde, ihre Stadt berichten – und zwar auf Deutsch, en français, in italiano ed eir in rumantsch!

Seit fast zwei Jahren hält die Covid-19-Pandemie die Welt im Würgegriff und unsere Demokratie auf Trab. Grundlage der bundesrätlichen Pandemiebekämpfung war von Anfang an das Epidemiengesetz, dem 2012 rund 60 Prozent der Stimmberechtigten zugestimmt hatten. Der Bundesrat musste in der ersten Phase der Krise teilweise aber auch mit Notrecht regieren, um Menschenleben, das Gesundheitswesen sowie Arbeitsplätze und KMU zu schützen. Im September 2020 hat das Parlament mit dem Covid-19-Gesetz dann die schweizerische Pandemiepolitik auf eine demokratische Basis gestellt. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Am 13. Juni dieses Jahres hat das Volk diese Politik mit über 60% der Stimmen bestätigt. Als Reaktion auf die Entwicklung der Krise wurde das Gesetz mehrmals angepasst, so auch im März 2021. Über diese Anpassungen stimmen wir wegen eines erneuten Referendums jetzt ab. Sollte das Volk auch diese Revision annehmen, wäre die schweizerische Pandemiepolitik dreifach demokratisch legitimiert. Durch das Epidemiengesetz von 2012 sowie durch die zweifache Annahme des Covid-19-Gesetzes in diesem Jahr. Umso absurder und verantwortungsloser erscheint es, dass Kollegin Magdalena Martullo-Blocher noch vor wenigen Monaten an dieser Stelle zündelte, die Schweiz verkomme zur Diktatur. Ob sie sich für diese Ungeheuerlichkeit je entschuldigen wird?
Viel wichtiger ist ein erneutes Ja zum Covid-19-Gesetz. Zu viel steht auf dem Spiel. Die Revision weitet die wirtschaftliche Hilfe auf Personen, Institutionen und Unternehmen aus, die vorher nicht genügend unterstützt wurden. Dies gilt ganz besonders für die in Graubünden so wichtige Kultur, die Eventbranche und den Tourismus. Es geht aber auch um Unterstützung von Selbstständigerwerbenden, Sportclubs oder Institutionen der ausserfamiliären Kinderbetreuung. Zudem schafft das Gesetz die Grundlage für ein verbessertes Contact-Tracing und für die Förderung der Medikamentenentwicklung.
Am stärksten umstritten ist das Covid-Zertifikat. Das ist verständlich, denn es ist ein Eingriff in unsere Freiheit. Doch ohne Zertifikat bräuchte es wohl schärfere Beschränkungen. Denn der Bundesrat müsste als Alternative mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder erneute Lockdowns verfügen oder eine Impfpflicht einführen, um eine Überlastung der Spitäler und viele neue Todesfälle zu verhindern. Da ist das Zertifikat deutlich milder und damit verhältnismässig. Gerade angesichts der zu tiefen Impfquote und der steigenden Fallzahlen können wir darauf schlicht nicht verzichten.
Das Covid-19-Gesetz ist ein zentrales Instrument, um die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen dieser Krise zu meistern. Die Gegnerschaft macht mit schrillen Aktionen, haltlosen Vorwürfen und einer riesigen Kampagne auf sich aufmerksam. Sie ist aber eine Minderheit. Wir, die besonnene Mehrheit, müssen kein Tamtam veranstalten. Wir können einfach ein Ja auf den Zettel schreiben und das Abstimmungsmaterial rechtzeitig auf die Gemeinde bringen. Das allerdings müssen wir auch wirklich tun!
Dieser Text ist am 17. November 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Diesen Mittwochvormittag führt der Nationalrat auf Basis von drei dringlichen Interpellationen von SP, Grünen und Grünliberalen eine aktuelle Debatte zum Thema «Pandemie und Krankenpflege». Angesichts der übermenschlichen Arbeit, die seit Monaten in den Gesundheitseinrichtungen und insbesondere in den Intensivstationen unseres Landes geleistet wird, ist diese Auseinandersetzung nötig. Massnahmen zur Unterstützung der Pflege und gegen den wachsenden Personalmangel in Spitälern, Heimen und bei der Spitex sind dringend. Doch bis jetzt sind die politischen Beschlüsse in Bern ungenügend. Darum braucht es ein klares Wort des Volkes.
Als der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) im Januar 2017 die Pflegeinitiative lancierte, konnte niemand ahnen, dass wir uns zum Zeitpunkt der Abstimmung mitten in der schwersten Pandemie seit der Spanischen Grippe von 1918 befinden würden. Noch weniger vorhersehbar war, dass wir am 28. November 2021 zeitgleich auch über die Rechtsgrundlage für das Covid-Zertifikat abstimmen würden. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass diese beiden Vorlagen am Schluss dieselben Fragen aufwerfen: Nehmen wir als Gesellschaft Rücksicht auf die Pflegerinnen und Pfleger, die unsere Spitäler und Intensivstationen auch in der Pandemie am Laufen halten? Bringen wir denjenigen den nötigen Respekt entgegen, die am Rande der Erschöpfung Kranke pflegen und viel Leid lindern? Sichern wir unser Gesundheitswesen in dieser Krise und darüber hinaus? Bejahen wir diese Fragen, sollten wir drei Dinge tun.
Erstens sollten wir am 28. November die Pflegeinitiative annehmen, damit der Beruf gestärkt wird. Nur so verhindern wir, dass sich der Personalmangel verschärft. Denn wir können von so wichtigen Berufsleuten wie den Pflegerinnen und Pflegern nicht erwarten, dass sie zugleich hoch qualifiziert, ständig verfügbar, immer empathisch und ausserordentlich mutig sind, ohne ihnen anständige Arbeitsbedingungen und faire Löhne zu gewähren.
Zweitens sollten wir am 28. November das Covid19-Gesetz annehmen, damit neben den wirtschaftlichen Hilfen auch das Covid-Zertifikat bestehen bleibt. Es sorgt erwiesenermassen dafür, Ansteckungen zu reduzieren. Und es sorgt dafür, dass wir einigermassen frei leben können, ohne die Intensivstationen an den Anschlag zu bringen. Die Zahl der verfügbaren Plätze in der Intensivpflege ist weniger ein Problem der Infrastruktur, sondern des verfügbaren Personals. Seit 18 Monaten leisten diese Profis Übermenschliches am Rande der Überlastung. Umso respektloser ist die Einstellung, mehr Ansteckungen seien in Kauf zu nehmen, da es im Notfall die Spitäler schon richten würden.
Drittens tragen wir alle eine persönliche Verantwortung dafür, das Virus in Schach zu halten und das Gesundheitssystem zu schützen. Jede Person, die sich impfen lässt, verringert das Risiko, auf der Intensivstation zu landen. Sie schützt damit sich selbst und eben auch andere.
In der ersten Welle der Pandemie haben wir für das Pflegepersonal geklatscht. Nach 18 Monaten Pandemie reicht Applaus definitiv nicht mehr. Die Pflege braucht echten Respekt. Wir können diesen Respekt erweisen, indem wir der Pflegeinitiative und dem Covid19-Gesetz zustimmen – und uns impfen lassen.
Dieser Text ist am 29. September 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.
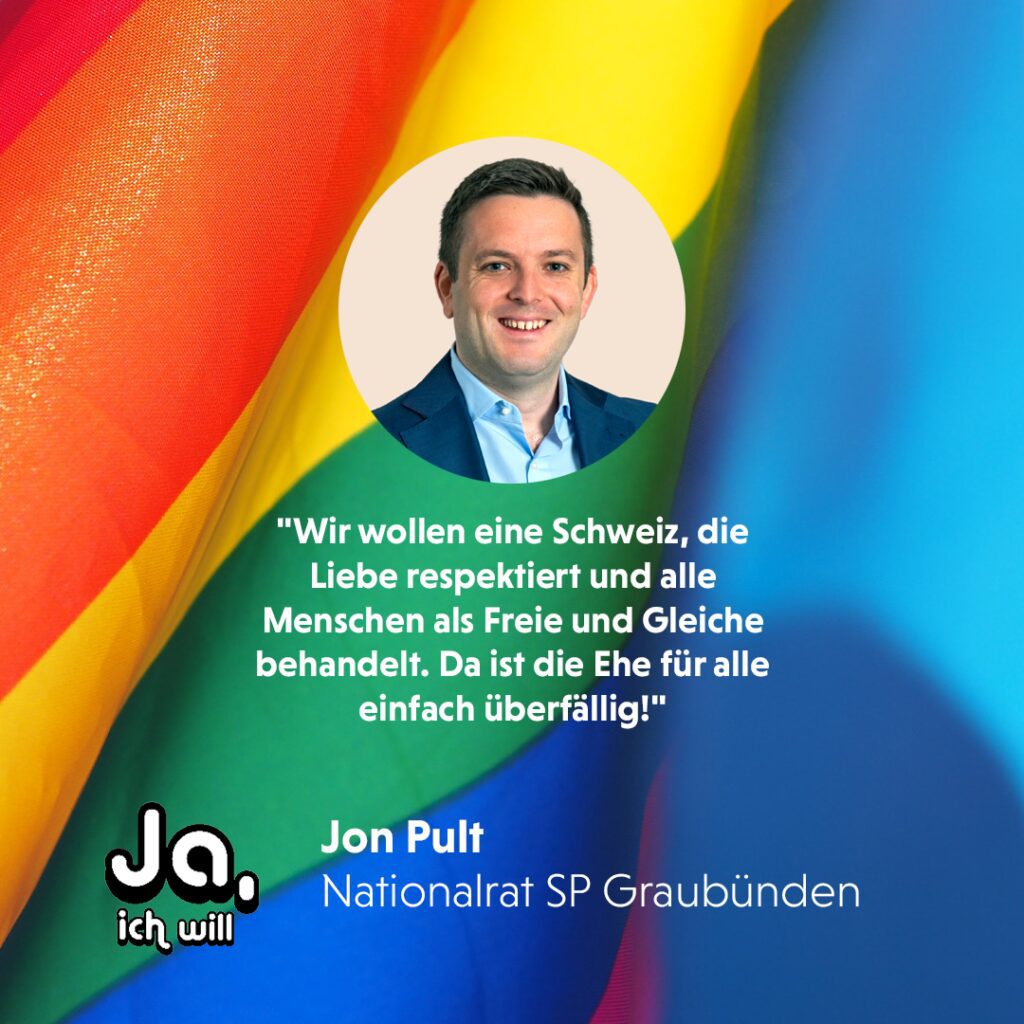
Zur Schliessung einer Ehe kann man mit vielen guten Gründen Ja oder Nein sagen. Aber es gibt keinen einzigen guten Grund, warum nicht alle Menschen das Recht haben sollten, diesen Entscheid frei zu treffen. Es ist Zeit, dass wir damit aufhören, unsere queeren Mitmenschen zu diskriminieren. Wir wollen eine Schweiz, die Liebe respektiert und alle Menschen als Freie und Gleiche behandelt. Darum ist ein Ja zur Ehe für alle am 26. September einfach überfällig!

Die 99-Prozent-Initiative will die Gewichte in der Steuerpolitik verschieben. Wer arbeitet, soll besser dastehen, als wer nur sein Geld «arbeiten» lässt. Wir wollen Einkommen aus Kapital künftig höher besteuern als Arbeitseinkommen. Zum Kapitaleinkommen zählen zum Beispiel Dividenden oder Kursgewinne auf Aktien. Kapitaleinkommen würden neu ab einem Schwellenwert von 100’000 Franken zum eineinhalbfachen Wert besteuert. Wer pro Jahr also mehr als 100’000 Franken durch Aktienbesitz verdient, soll für jeden Franken über dieser Schwelle auf 1.50 Franken Steuern zahlen. Das beschert unserem Gemeinwesen Mehreinnahmen, die wir wiederum für Steuersenkungen oder Unterstützungsleistungen für Arbeitseinkommen einsetzen. Hohe Kapitaleinkommen zahlen etwas mehr, Arbeitseinkommen profitieren. Das ist fair, denn nur Arbeit schafft echte Werte.
Das heutige Steuersystem ist hingegen ungerecht, weil es die Superreichen privilegiert. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es bei uns keine Kapitalgewinnsteuer. Und Dividenden müssen auch nicht vollständig versteuert werden, sofern jemand mehr als zehn Prozent der Aktien eines Unternehmens hält. Hingegen müssen normale Menschen jeden Lohn- oder Rentenfranken komplett versteuern. Mit der 99-Prozent-Initiative können wir diese Ungerechtigkeit korrigieren.
Das ist dringend nötig. Denn die wirtschaftliche Ungleichheit hat in der Schweiz ein ungesundes Ausmass angenommen. Die obersten zehn Prozent der Bevölkerung besitzen rund drei Viertel des Reichtums und vermehren ihn Jahr für Jahr praktisch ohne eigene Arbeitsleistung. Diese Entwicklung ist eine Gefahr für den Zusammenhalt und für die Demokratie in unserem Land. Die 99%-Initiative ist ein gutes Mittel, endlich Gegensteuer zu geben.
Dieser Text ist als Meinungsbeitrag in der Südostschweiz vom 1. September 2021 erschienen.

Der Weltklimarat spricht in seinem jüngsten Bericht Klartext. Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg, Hitzewellen, Dürren und Starkniederschläge lassen sich noch sicherer vorhersagen als bisher. «Menschlicher Einfluss hat das Klima so aufgeheizt, wie es seit mindestens 2000 Jahren nicht mehr vorgekommen ist», heisst es im vorgestern publizierten Bericht. Und: «2019 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre höher als zu jedem anderen Zeitpunkt seit mindestens zwei Millionen Jahren.» Die Hitzewellen und Waldbrände in Nordamerika oder Südeuropa, die Extremniederschläge in Mitteleuropa inklusive tödlicher Flutkatastrophe in Deutschland sind also nicht Einzelereignisse, sondern die letzten Vorboten der nicht mehr bestreitbaren Klimakrise.
Die politische Antwort, wie das Klima stabilisiert und aus der Krise nicht eine dauerhafte Katastrophe wird, liegt eigentlich vor. 2015 hat sich die Welt mit dem Pariser Klimaabkommen darauf geeinigt, den Ausstoss von Treibhausgasen so zu reduzieren, dass der Temperaturanstieg auf 1,5°C begrenzt wird. Dies gilt auch für die Schweiz. Mit dem am 13. Juni abgelehnten CO2-Gesetz hätten wir die erste Etappe bis 2030 erfüllt. Persönlich steckt mir der Frust über diese Niederlage noch in den Knochen. Doch das ändert nichts daran, dass die Klimapolitik absolute Priorität haben muss. Dafür braucht es jetzt eine saubere Analyse und kluges Polithandwerk.
Nebst der Mobilisierung konservativer Kräfte durch die Agrarinitiativen gibt es zwei inhaltliche Gründe für die Ablehnung des Gesetzes. Erstens: Viele Menschen hatten das Gefühl, sie müssten sich einschränken, während man die grossen Fische nicht antastet. Zumindest in Bezug auf den Klimasünder Finanzplatz stimmte das. Zweitens: Die mögliche Verteuerung des Benzins und die Lenkungsabgaben auf Brennstoffe und Flugtickets wurden von vielen als Strafen empfunden, die wiederum nur die einfachen Leute treffen. Denn ob Benzin, Heizöl oder Flugtickets teurer werden, könne den Reichen ja egal sein. Dank der sehr sozialen Ausgestaltung der Abgaben-Rückerstattung stimmte diese Wahrnehmung zwar nicht. Doch das komplizierte Lenkungssystem drang im Abstimmungskampf nicht durch.
Darum braucht es jetzt eine Klimapolitik, die nicht nur gerecht ist, sondern auch so empfunden wird. Gerecht sind strikte Regeln für Finanzplatz und Industrie einerseits. Und massive öffentliche Investitionen für den ökologischen Umbau andererseits. Geschäfte von Schweizer Finanzakteuren mit Kohle, Öl oder Gas brauchen ein gesetzliches Ablaufdatum. Autoimporteure müssen rasch zur Elektrifizierung der gesamten Neuwagenflotte verpflichtet werden. Produktevorschriften sind schnell zu verschärfen. Gleichzeitig braucht es eine gross angelegte Solaroffensive und eine stärkere Förderung von Haussanierungen mit einem Zuschlag für Eigentümer, welche die Mieten nicht erhöhen. Für das Berggebiet und den ländlichen Raum braucht es zudem eine gezielte Förderung der Elektromobilität und einen punktuellen Ausbau des ÖV. Genauso wie eine Vergünstigung der ÖV-Tickets für Menschen, die auf ein Auto verzichten. Und: Europa muss die Eisenbahn ausbauen und Kurzstreckenflüge verbieten.
Es braucht Regeln für Konzerne und Angebote für die Bevölkerung. Nur so schaffen wir Mehrheiten und retten die Schweizer Klimapolitik.
Dieser Text ist am 10. August 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Den 1. August feiern heisst die Schweiz feiern – unsere Vielfalt, unsere Werte, unsere Errungenschaften. Wir erzählen uns Mythen und Geschichten zum Werdegang unseres Landes. Wir betonen Grundsätze unserer Willensnation wie Freiheit, Gemeinsinn, Demokratie.
Diese Tradition ist trotz den konstruierten Mythen um das Rütli wertvoll. Gerade weil an den meisten Orten unseres Landes eine sehr pragmatische Heimatliebe gelebt wird. Wir mögen unseren Bundesstaat und wir schätzen – meistens – seine insgesamt gut funktionierenden Institutionen und Leistungen. Diese pragmatische Sicht auf unsere Nation ist eine Stärke der Schweiz.
Aber wie alle Nationen müssen auch wir aufpassen, nicht einem dumpfen «Hurra-Patriotismus» zu verfallen. Denn er würde uns nur den Blick für reale Herausforderungen vernebeln. Darum begehen wir den 1. August lieber mit Offenheit gegenüber der Zukunft als mit rückwärtsgewandten Switzerland-First-Parolen. Das ist gesunder Patriotismus. Einstehen für eine bessere Schweiz, in der wir alle gerne leben – und die wir alle lieben können.
Teil dieses gesunden Patriotismus ist auch eine kritische Haltung. Sie sorgt dafür, dass wir genau hinschauen, wo unsere Vergangenheit nicht so ehrenhaft war oder wo es heute noch Ungerechtigkeiten oder Defizite gibt.
Die kritische Haltung sorgt dafür, dass wir unsere Kraft als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger daraus schöpfen, unsere Gemeinde, unseren Kanton und unseren Bundesstaat verbessern zu wollen – für alle Bewohnerinnen und Bewohner und für die kommenden Generationen.
Mit dieser Haltung spreche ich heute zu Ihnen. Darum will und muss ich das 50-jährige Jubiläum der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts ins Zentrum meiner Ansprache stellen. Denn die Schweiz ist, da müssen wir ehrlich zueinander sein, eine sehr junge Demokratie. Zumindest wenn man Demokratie als Herrschaft des Volkes innerhalb einer Gesellschaft von freien und gleichen Menschen versteht.
Als die Schweizer Männer 1971 dem Stimm- und Wahlrecht für Frauen endlich zustimmten, waren über 100 Jahre vergangen, seit die Genferin Marie Goegg-Pouchoulin als wohl erste Schweizer Frauenrechtlerin zum ersten Mal gleiche politische Rechte für Schweizer Frauen gefordert hatte. Von dieser erstmaligen Forderung bis zur politischen Gleichberechtigung der Hälfte unserer Bevölkerung dauerte es über ein Jahrhundert. Es brauchte also 100 Jahre politischen Kampf für bisher 50 Jahre politische Gleichberechtigung.
Die Frauen dieses Landes haben doppelt so lange für ihr Menschenrecht auf gleiche Mitbestimmung streiten müssen, als sie es heute haben. Oft wurden sie beschimpft, zum Teil bedroht und fast immer lächerlich gemacht. Viele dieser Kämpferinnen haben den demokratischen Durchbruch gar nicht mehr erlebt. Andere leben heute noch und erinnern uns daran, wie mühselig der Weg zur echten Schweizer Demokratie war.
Noch 1959, 12 Jahre vor dem Durchbruch von 1971, scheiterte die Einführung des Frauenstimmrechts überdeutlich an einem Männermehr von Volk und Ständen.
Nur die Westschweizer Kantone Neuenburg, Waadt und Genf stimmten zu. Und selbst die Freisinnigen und die Christdemokraten, die wichtige Vorkämpferinnen für das Frauenstimmrecht in ihren eigenen Reihen hatten, beschlossen 1959 mutlos die Stimmfreigabe.
Und all dies obwohl zu diesem Zeitpunkt schon in praktisch allen europäischen Staaten seit Jahrzenten das gleiche Wahl- und Stimmrecht für Frauen und Männer galt. Nur in Portugal und in Lichtenstein dauerte es noch länger als in der Schweiz. In Portugal musste 1974 zuerst die faschistische Salazar-Diktatur mit der Nelkenrevolution überwunden werden. Im erzkonservativen Fürstentum tickten die Uhren noch etwas langsamer als in der Schweiz.
1971 war also ein sehr später aber ein ebenso grosser Durchbruch in der Geschichte unseres Landes. Wir alle – Frauen wie Männer – müssen ihn gedenken und feiern.
Frauen wie die erwähnte Genfer Frauenrechtlerin Marie Goegg-Pouchoulin haben das möglich gemacht. Oder wie die Bündnerin Meta von Salis, die schon 1896 in einem vielbeachteten Zeitungsartikel unter dem Titel «Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau» die revolutionäre Aussage machte, die volle Gleichberechtigung der Frauen sei eine «Prämisse des bürgerlichen Staates».
Aber auch jüngere Frauenrechtlerinnen wie Iris von Roten, die 1958 mit ihrem Buch «Frauen im Laufgitter» für viele rote Köpfe sorgte aber dazu beitrug, dass mit der Zeit die Stimmung zugunsten der politischen Gleichberechtigung kippte, gebührt unser Dank.
Genauso wie tausenden von Frauen, die sich noch ohne politischen Rechte am Arbeitsplatz, in den Gemeinden, in Parteien, in Gewerkschaften oder in Verbänden organisierten und engagierten, die lautstark demonstrierten und protestierten und vor allem jahrzehntelang in ihrer politischen Basisarbeit nicht lockerliessen. Ihnen und auch einigen solidarischen Männern gilt heute unsere Dankbarkeit.
Sie sind es, die unser Land erst zur wirklichen Demokratie gemacht haben.
Sie sind es, die Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und des Kreises Churwalden, heute ermöglichen, mit Margrith Raschein eine Gemeindepräsidentin und mit Brigitta Hitz-Rusch eine Grossrätin zu haben.
Sie, die Vorkämpferinnen und Vorkämpfer für gleiche Rechte in unserem Land, sie sind es, die vor 50 Jahren ein grosses Stück echte Freiheit und echten Gemeinsinn geschaffen haben.
Sie müssen wir an diesem 1. August ehren. Ihre Weitsicht wollen wir uns zum Vorbild nehmen. Gerade auch mit Blick auf die kommenden Herausforderungen unseres Landes.
Wenn es zum Beispiel darum geht, in der Arbeitswelt gleiche Chancen und gleiche Löhne für gleiche Arbeit durchzusetzen und eine Familienpolitik auf den Weg zu bringen, die diesen Namen verdient.
Oder wenn es darum geht, mit wirksamer Klima- und Umweltpolitik oder einer klugen Weiterentwicklung unserer Beziehung zu Europa die Rechte und Chancen der künftigen Generationen zu wahren.
Oder wenn es darum geht, auch Menschen mit einer Behinderung, Menschen mit einer anderen Herkunft oder Menschen mit einer anderen sexuellen Identität oder Orientierung gleiche Rechte zu geben.
Wenn wir in Zukunft an solche und andere Herausforderungen denken, sollten wir auch an die Vorkämpferinnen und Vorkämpfer für das Frauenstimmrecht denken.
Sie haben es geschafft, abstrakten Grundsätzen unseres Bundesstaates – Freiheit, Gemeinsinn und Demokratie – konkret Leben einzuhauchen. Sie haben sich nicht entmutigen lassen. Sie standen auf der richtigen Seite der Geschichte. Heute, 50 Jahre nach ihrem Erfolg, dienen sie uns als Quelle der Inspiration.
Mögen sie uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern helfen, die Kraft zu schöpfen, unsere Gemeinde, unseren Kanton und unseren Bundesstaat verbessern zu wollen – für alle Bewohnerinnen und Bewohner und für die kommenden Generationen.
Für eine bessere Schweiz, in der wir alle gerne leben – und die wir alle lieben können.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen 1. August.

Unser Land liegt geografisch, kulturell und wirtschaftlich im Herzen Europas. Fussballerisch sowieso! Seit dem grandiosen Sieg über Weltmeister Frankreich lassen uns Xhaka, Sommer, Seferović und Co. sogar europäisch träumen. Gebannt werden wir heute ab 18 Uhr auf die Schirme blicken und gegen Spanien auf eine Wiederholung der Sensation hoffen. Dann noch die Scharte gegen Italien auswetzen oder Belgien schlagen, um im grossen Finale… die Sport-Schweiz ist vom Europa(meisterschafts)-Taumel ergriffen!
Ganz anders die Politik. Der Bundesrat hat am 26. Mai die Verhandlungen über ein Institutionelles Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU abgebrochen. Einen Plan B hat er nicht aufgezeigt. Das ist komplett verantwortungslos. Der von der SP aufgezeigte Lösungsweg – die Unionsbürgerrichtlinie (UBRL) wird von der Schweiz weitgehend übernommen, im Gegenzug erhält die Schweiz Garantien für einen eigenständigen Lohnschutz – wurde nicht einmal versucht. Dies ist umso unverständlicher, als genau dieser Weg auch von der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates und von Bundesrätin Viola Amherd vorangetrieben wurde.
Ende der bilateralen Gemütlichkeit
Selbstkritisch müssen wir von der SP festhalten, dass wir diese Idee zu spät eingebracht haben. Niemand hat sich bei diesem Dossier mit Ruhm bekleckert. Das Systemversagen der Schweizer Politik hat aber einen klaren Anfang: Der fundamentale Vertrauensbruch von FDP-Bundesrat Cassis gegenüber den Gewerkschaften. Der Aussenminister liess bewusst oder unbewusst zu, dass seine Diplomaten den so wichtigen Lohnschutz in Frage stellten. Und zwar in eklatanter Verletzung des damaligen Verhandlungsmandates. Diesen Schaden hat der Bundesrat weder aussenpolitisch ausgemerzt noch innenpolitisch gekittet.
Beispiellos unverantwortlich war auch die Entscheidung unserer Regierung, Medien und Interessengruppen über einen nicht fertig verhandelten Vertragsentwurf diskutieren zu lassen, den sie politisch nie gewürdigt oder eingeordnet hat. Weil der Bundesrat nie eine konsistente Gesamtsicht auf unser Verhältnis zu unseren Nachbarn anbot, drängte er die innenpolitischen Akteure faktisch dazu, nur ihre Partikularinteressen zu sehen. So gingen in der Schweiz Kompromissbereitschaft und Kreativität flöten, die es immer braucht, um in einer verfahrenen Situation doch noch eine Lösung zu finden. Das Resultat ist der Abbruch in die Ratlosigkeit – und das Ende der bilateralen Gemütlichkeit.
Isolieren oder integrieren?
Nun braucht es neue Perspektiven in der Schweizer Europapolitik. Dafür müssen wir grundsätzlich werden. Wollen wir uns isolieren und uns ganz autonom der Welt anpassen? Oder wollen wir uns in Europa integrieren und unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten? Mir scheint zweiteres attraktiver. Mehr Integration heisst dann aber auch, dass wir uns in eine Rechtsgemeinschaft einfügen. Eine Integration à la carte gibt es nicht. Es wird Kompromisse brauchen. Dafür können wir mitreden und mitentscheiden. Ob das in Form eines verbesserten institutionellen Vertrags, über den Beitritt zum EWR oder sogar einer Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union geschieht, ist zu diskutieren. Aus demokratischer Sicht scheint mir die Vollmitgliedschaft schon immer die beste Option. Aber ich lasse mich gerne von anderen Lösungen überzeugen.
Unbestritten sollten hingegen zwei Grundsätze sein. Erstens: Ein Zurück zu unabhängig voneinander oder sogar gegeneinander handelnden Nationalstaaten in Europa darf es nicht geben. Frieden, Freiheit, Wohlstand und den ökologischen Umbau schaffen wir nur gemeinsam. Zweitens: Mehr Integration in Europa funktioniert dann, wenn sie mit sozialem Fortschritt für die Bevölkerung verbunden wird. Darum sind Lohnschutz und soziale Sicherheit eine Voraussetzung für ein starkes Europa – und für eine europäische Schweiz. Ja, wir sollten nicht nur im Fussball europäisch träumen. Die Zukunft unseres Kontinents ist schliesslich auch unsere Zukunft. Hopp Schwiiz!
Dieser Text ist am 2. Juli 2021, dem Tag des EM-Viertelfinals Schweiz-Spanien als Gastkommentar im Bündner Tagblatt erschienen.

Der Niedergang der Medienvielfalt in den Regionen ist einer der Gründe für die Krise der amerikanischen Demokratie. In den USA gibt es praktisch keine regionalen Zeitungen oder Online-Portale und faktisch keinen Lokaljournalismus mehr. Die Menschen wissen nicht, was vor Ort passiert. Dieses Informationsvakuum nutzen Populisten und Propagandisten aus, die auf Sendern wie Fox News und in Social-Media-Filterblasen ihre Lügen und Verschwörungstheorien verbreiten. Dass ein egomanischer Antidemokrat wie Donald Trump Präsident werden konnte, hat auch damit zu tun. Denn ohne Medienvielfalt in allen Regionen eines Landes ist die vierte Staatsgewalt faktisch kastriert.
Damit dieser amerikanische Albtraum nicht zu uns überschwappt und auch unsere Demokratie beschädigt, müssen wir der Medienvielfalt Sorge tragen. Für ein viersprachiges, föderalistisches und direktdemokratisches Land wie die Schweiz gilt dies umso mehr. Darum habe ich mich im Nationalrat seit über einem Jahr für ein tragfähiges Massnahmenpaket zugunsten der Medien eingesetzt. Es brauchte unzählige Kommissionssitzungen, eine Rückweisung der Vorlage an die Kommission durch den Nationalrat, drei Differenzbereinigungen zwischen den Räten und eine Einigungskonferenz, bis wir nach vielen Verbesserungen und Kompromissen am Ziel waren. Am letzten Freitag beschlossen National- und Ständerat mit recht komfortablen Mehrheiten das wichtige Medienpaket.
Wichtig ist es, weil die Medienvielfalt und der Journalismus auch bei uns leiden. Redaktionen werden zusammengestrichen, Zeitungen werden dünner und immer mehr Titel kämpfen ums Überleben. Der Hauptgrund sind die wegfallenden Werbeeinnahmen, mit denen man bisher den Journalismus finanzieren konnte. In rund zehn Jahren haben sich die Werbeeinnahmen der Schweizer Medien mehr als halbiert!
Dieser Rückgang liegt nicht etwa daran, dass heute weniger Werbung geschaltet würde. Im Gegenteil. Die Werbegelder fliessen reichlich, einfach zu einem wachsenden Teil nach Kalifornien zu den Tech-Giganten wie Google und Facebook. Das Kuchenstück für die Schweizer Verlage wird hingegen immer kleiner. Die gefährliche Folge dieses Strukturwandels ist Medienkonzentration beim Inhalt, aber auch bei den Besitzverhältnissen. Inhaltlicher Einheitsbrei ist für unsere Demokratie ebenso schädlich wie die Dominanz von wenigen Medienkonzernen. Beides schreitet leider auch in der Schweiz voran. Natürlich: In Nischen entstehen auch neue, Mut machende Online-Projekte. Doch der generelle Trend ist insgesamt klar negativ.
Darum hat das Parlament mit dem Massnahmenpaket zugunsten der Medien gehandelt. Damit greifen wir als Gemeinschaft den verbleibenden Zeitungen und Zeitschriften finanziell etwas stärker unter die Arme, wir fördern neu die zukunftsgerichteten Online-Medien und wir stützen das gesamte System durch Ausbildung, Agenturwesen und Projektförderung im IT-Bereich. Das ist dringend nötig, wenn wir wollen, dass die Bevölkerung auch in Zukunft unabhängige Zeitungen und Online-Portale hat, die über ihre Region, ihre Gemeinde, ihre Stadt berichten – und zwar auf Deutsch, en français, in italiano ed eir in rumantsch!
Dieser Text ist am 23. Juni 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Das CO2-Gesetz ist kein visionärer Wurf. Aber es sorgt dafür, dass die Schweiz die Verpflichtungen des Pariser Klimaschutz-Abkommens erfüllt. Bei einem Ja reduzieren wir unseren CO2-Ausstoss bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990. Für das Klima und damit auch für die Zukunft der Alpen als Lebensraum ist das existenziell. Ein Nein wäre klimapolitisch katastrophal und wirtschaftlich eine verpasste Chance.
Die Parteien SP, FDP, Mitte, Grüne und Grünliberale, die meisten Wirtschaftsverbände, alle Umweltorganisationen und unzählige Bürgerinnen und Bürger engagieren sich darum für ein Ja. Nur die SVP ist der Erdöl-Lobby auf den Leim gekrochen. Damit verteidigen ausgerechnet die selbsternannten Patrioten die Pfründe der ausländischen Öl-Konzerne. Für Sie wie für die Erdgasverkäufer geht es um nicht weniger als 8 Milliarden Franken pro Jahr. So viel gibt die Schweiz jährlich für den Import von fossiler Energie aus.
Mit dem CO2-Gesetz reduzieren wir diese wirtschaftliche Abhängigkeit. Jeder Franken, der nicht in zweifelhafte Regimes wie Kasachstan, Russland oder Libyen fliesst, schafft hier Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Denn das Gesetz fördert notwendige Investitionen in der Schweiz und in Graubünden. Wir werden die Energieeffizienz unserer Gebäude und Infrastrukturen verbessern sowie mehr erneuerbare Energie produzieren. Dabei kommt gerade Graubünden zugute, dass die Energie in Form von Wasser und Sonnenschein kostenlos vorhanden ist. Dies im Gegensatz zum Öl, das teuer eingekauft werden muss.
Die vom Temperaturanstieg besonders betroffenen Bergkantone erhalten mit dem im Gesetz neu geschaffenen Klimafonds auch Gelder, um sich mit Schutzbauten besser gegen Naturgefahren wie Bergstürze, Murgänge und Steinschläge zu schützen. Weiter werden die Sanierung von Gebäuden, Ladestationen für Elektroautos, die Beschaffung von Elektrobussen oder die Planung und Finanzierung von Fernwärmenetzen gefördert. Alles Zukunftschancen für unsere Bündner Wirtschaft.
Und das Beste daran: Die Kosten der Klimaschutzmassnahmen sind moderat und fair verteilt. Mehr als die Hälfte der Gelder aus der CO2-Abgabe auf Brennstoffe und aus der Flugticketabgabe wird über eine Verbilligung der Krankenkassenprämien pro Kopf an die Bevölkerung zurückverteilt. Familien und wir in den Bergen profitieren überdurchschnittlich davon. Denn wir fliegen deutlich weniger als die Bevölkerung im Unterland. Und der Anteil der schon heute erneuerbaren Heizungen ist in Graubünden deutlich höher als in den grossen Städten und Agglomerationen.
Ausserdem bekommen wir die Folgen der steigenden Temperaturen zuallererst zu spüren. Die Naturereignisse nehmen bei uns zu, nicht im Unterland. Darum ist Klimaschutz auch ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber der Bergbevölkerung. Umso wütender macht es mich, wenn die Gegner des CO2-Gesetzes uns Berglerinnen und Bergler wie Hinterwäldler behandeln, denen ein paar Rappen Benzinpreis wichtiger sind als der Klimaschutz. Diese Respektlosigkeit lassen wir uns nicht bieten. Mit einem deutlichen Ja zum CO2-Gesetz zeigen wir der Erdöl-Lobby, dass wir Berglerinnen und Bergler uns nicht instrumentalisieren lassen.
Dieser Text ist am 5. Mai 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Der «Beobachter» publizierte vor gut drei Jahren eine grosse Reportage der Bündner Journalistin Stefanie Hablützel mit dem Titel: «PCB. Das Gift, das man vergessen möchte». Angestossen vom grossen Schadensfall am Bergbach Spöl im Herbst 2016 arbeitete Hablützel detailliert auf, wie gross die Probleme mit der Industriechemikalie PCB in der Schweiz wirklich sind. Tatsächlich ist das Gift überall. Gemäss einer Studie der ETH waren 2019 schweizweit noch rund 200 Tonnen davon verbaut. PCB steckt in Kraftwerksanlagen, aber auch auf Dächern, Gebäudehüllen und in der Farbe von Stallwänden. Letzteres ist wegen der Nähe zu den Tieren und damit zur Lebensmittelproduktion besonders problematisch. Denn PCB ist eine der giftigsten Chemikalien überhaupt. Es gilt gemäss Weltgesundheitsorganisation als krebserregend, greift das Hormonsystem an und kann in der Natur nicht abgebaut werden. Entsprechend ist der Stoff seit dem Inkrafttreten der «Stockholm-Konvention» 2004 weltweit verboten. Die Schweiz verbot den Stoff bereits 1986.
Doch unser Land tut sich schwer mit der Bereinigung dieser Altlast. Gemäss «Stockholm-Konvention» müsste das PCB bis 2028 «eliminiert» sein. Davon sind wir noch weit entfernt. Exemplarisch dafür ist der Streit um die Sanierung des Spöl im Schweizerischen Nationalpark. Während die Verantwortlichen des Nationalparks völlig zu Recht auf einer umfassenden Sanierung beharren, hat die Engadiner Kraftwerke AG die Verhandlungen im Dezember 2020 platzen lassen. Man habe sich über den «Sanierungsumfang» nicht einigen können. Im Klartext: Die EKW AG will keine vollumfängliche Sanierung finanzieren und setzt auf die Verzögerung des gerichtlichen Wegs. Oder darauf, dass der Kanton die Nerven verliert und die Sanierung mit Steuermitteln bezahlt. Das ist skandalös. Denn als Betreiberin der Staumauer ist sie für die Kontaminationsquelle verantwortlich. Da muss sie auch für den Schaden geradestehen. So einfach ist das. Umso wichtiger ist, dass die Bevölkerung und die Gemeinden des Unterengadins den Verantwortlichen des Nationalparks den Rücken stärken und die EKW AG zur Raison bringen.
Auch die Politik in Bern und Chur muss vorwärts machen. Die Umweltbehörden von Bund und Kanton müssen wissen, dass vorauseilender Gehorsam gegenüber den mächtigen Kraftwerksgesellschaften nicht goutiert wird. Im Gegenteil. Die Bevölkerung erwartet, dass das PCB-Problem gelöst statt verschlampt wird. Am Spöl aber auch sonst überall – in allen betroffenen Flüssen, in allen betroffenen Siedlungen und in allen betroffenen Landwirtschaftsbetrieben. Darum braucht es einen Plan und mehr Engagement des Bundes – sowie nötigenfalls neue gesetzliche Vorgaben. Dafür setzte ich mich im Nationalrat ein. Diese Woche mit Fragen und Interpellationen an den Bundesrat. Und in Zukunft – wenn es nötig sein sollte – auch mit stärkeren parlamentarischen Mitteln. Denn die Politik darf das Gift PCB nicht vergessen. Sie muss es eliminieren.
Dieser Text ist am 17. März 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Vier Jahre Donald Trump haben die älteste Demokratie der Welt an den Rand des Abgrunds gebracht. Seine Lügen, seine Korruption, sein Sexismus und sein Rassismus haben die bereits polarisierte US-Gesellschaft definitiv zerrüttet. Soziale Ungleichheit und Diskriminierungen von Minderheiten prägen den Alltag. Wut und Hass dominieren die Debatte. Der Angriff eines faschistischen Mobs auf das Kapitol war der bisherige Tiefpunkt dieses amerikanischen Albtraums.
Diesseits des Atlantiks waren wir seit Trumps Wahl besorgt. Aber allmählich machte sich auch Abstumpfung breit. Das war und ist gefährlich. Denn Trump und seine Fans konstruieren «alternative Fakten» und schaffen so ideologische Parallelwelten, in die auch europäische Nationalisten hinabsteigen. Für die Salvinis, Le Pens, Straches, Höckes und Köppels ist Trump ein Vorbild. Denn er hat vorgemacht, wie man als demokratisch gewählter Amtsträger die Macht dazu missbrauchen kann, demokratische Institutionen auszuhöhlen. Bis heute distanzieren sich Trumps europäische Fans darum nicht von ihm.
Barack Obama sagte im August des letzten Jahres, bei der Präsidentschaftswahl gehe es um das Überleben der amerikanischen Demokratie. Dass er nicht übertrieben hat, beweist Trumps Leugnung der klaren Niederlage. Sein wichtigstes Vermächtnis bleibt diese grosse Lüge, der leider Millionen auf den Leim gegangen sind. So zersetzt Trump auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft die amerikanische Demokratie.
Für den Yale-Historiker Timothy Snyder ist der Niedergang der regionalen Medienvielfalt und des medialen Service Public ein wichtiger Grund für die Krise der amerikanischen Demokratie. In den meisten Regionen der USA gibt es keine regionalen Medien und keinen lokalen Journalismus mehr. Die Menschen wissen nicht, was vor Ort passiert. In dieses Informationsvakuum springen Propagandisten, die auf Sendern wie Fox News und in Social-Media-Filterblasen ihre Desinformation betreiben. Wie Lauffeuer verbreiten sich Lügen und Verschwörungstheorien. Davon leben Antidemokraten wie Trump. Darum müssten gemäss Snyder die Internetkonzerne zerschlagen und Social-Media-Plattformen wie Facebook besteuert werden. Mit den Einnahmen sei der lokale Journalismus zu finanzieren. Schliesslich geht der Niedergang der Medienvielfalt darauf zurück, dass Google und Facebook praktisch alle Werbeeinnahmen abgezogen haben – ohne dass diese Plattformen irgendeinen journalistischen Inhalt produzieren würden.
«Die Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen suche», hat James Joyce eine Hauptfigur seines Ulysses sagen lassen. Seit letzter Woche sitzt zum Glück kein Antidemokrat mehr im Weissen Haus. Die Welt ist erwacht. Doch damit der amerikanische Albtraum nicht zurückkehrt, müssen wir uns überall für die Demokratie engagieren. Auch bei uns. Es braucht unseren Einsatz für Medienvielfalt und für einen medialen Service Public auf der Höhe des digitalen Zeitalters. Darum geht es beim Massnahmenpaket zugunsten der Medien, welches wir aktuell in der zuständigen Kommission beraten. Ziel ist es, die Zeitungszustellung besser zu finanzieren, die Branche insgesamt zu stärken und neu auch redaktionelle Online-Medien zu fördern. Hoffentlich sieht eine Mehrheit in Bern, wie bedeutend dieser Schritt für unsere Demokratie ist.
Dieser Text ist am 27. Januar 2021 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Die ersten Corona-Welle hat die Schweiz gut gemeistert. Der Bundesrat gab der Gesundheit oberste Priorität und handelte entschlossen für das ganze Land. Die Bevölkerung verstand seine Botschaften. Das Virus wurde erfolgreich eingedämmt. Die Anzahl der Todesfälle war im internationalen Vergleich tief. Die ersten Wirtschaftshilfen wurden rasch und unbürokratisch ausbezahlt. Solidarität prägte die Debatte, Vernunft das Handeln von Politik und Bevölkerung.
Ganz anders in der zweiten Welle. Statt einem entschlossenen Bundesrat erlebten wir kantonale Kakophonie. Das Verbandslobbying für möglichst lasche Massnahmen und das Knausern der Bürgerlichen bei den Wirtschaftshilfen dominierten die Szene. Die überhöhte «Eigenverantwortung» versagte, der «Schweizer Weg» scheiterte gesundheits- und wirtschaftspolitisch. Frust machte sich breit, die Vernunft ging vielerorts flöten.
Die Folgen sind tödlich. Zwischen Anfang November und Ende Dezember 2020 stand die Schweiz auf dem Übersterblichkeitsmonitor von Euromomo an der Spitze. In keinem anderen Land Westeuropas starben in dieser Periode mehr Menschen im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung. Mittlerweile hat der Bundesrat die Zügel wieder in die Hand genommen. Die Infektions- und Hospitalisierungszahlen sinken langsam wieder. Wir haben aber weiterhin Übersterblichkeit. Die Situation in den Spitälern und Heimen bleibt kritisch. Das Gesundheitspersonal ist seit Monaten am Anschlag. Die Mutationen des Virus bereiten grosse Sorgen.
Wirtschaftspolitisch haben SVP und FDP jede Glaubwürdigkeit verloren. Ihr Mantra, dass schwache Schutzmassnahmen gut für die Wirtschaft seien, ist Irrsinn. In einer Pandemie besteht die beste Wirtschaftspolitik darin, die Infektionszahlen tief zu halten und zugleich möglichst alle Ausfälle zu kompensieren. So rettet man wirtschaftliche Existenzen und stärkt die Akzeptanz der Eindämmungsmassnahmen. Doch statt auf die Wissenschaft zu hören, haben Ueli Maurer & Co. den Teufel neuer Schulden an die Wand gemalt. Und dies bei einem rekordverdächtig tiefen Schuldenstand und negativen Zinsen. Solche Faktenresistenz ist eine Gefahr für unser Land. Vorbildlich ist die Bündner Strategie der Massentest, die Peter Peyer durchgesetzt hat. Zusammen mit den Impfungen verspricht sie mittelfristig einen Ausweg aus dem Schlamassel. Umso unverzeihlicher wäre es, auch in einer dritten Welle zu versagen. Wir brauchen schnell tiefere Infektionszahlen und noch schneller grosszügige Entschädigungen. Nur das ist vernünftig und solidarisch. Genau dafür kämpft die SP.
Dieser Text wurde am 25. Januar 2021 verfasst und erschien im Februar 2021 als Artikel in der Mitgliederzeitung der SP Graubünden „Concret“.

Seit die Spanische Grippe vor über 100 Jahren wütete, wissen wir: Es kommen diejenigen Länder und Regionen wirtschaftlich am besten durch eine Pandemie, die das Virus am schnellsten und wirksamsten eindämmen. Das bestätigt sich in der aktuellen Krise. Wer wie die ostasiatischen Staaten, Neuseeland aber auch Finnland oder Deutschland am wenigsten Infizierte, Kranke und Tote zu beklagen hat, hat auch am wenigsten wirtschaftliche Schäden. Einen Gegensatz zwischen Gesundheit und Wirtschaft gibt es nicht. Voraussetzung für den Erfolg sind neben raschen und entschlossenen gesundheitlichen Massnahmen auch schnelle, unkomplizierte und vor allem grosszügige Staatshilfen. Für Arbeitnehmende, Selbstständige, Institutionen und Unternehmen. Das bestätigen praktisch alle Ökonominnen und Ökonomen. Jeden Franken, den wir als Staat jetzt in die Pandemiebekämpfung und in die wirtschaftliche Stützung stecken, sparen wir uns mehrfach bei den gesundheitlichen und sozialen Folgekosten. Die «Güterabwägung» zwischen Gesundheit und Wirtschaft, die Bundesrat Ueli Maurer gebetsmühlenartig beschwört, existiert in Wahrheit nicht.
Doch in Bern dominieren in der zweiten Welle diejenigen, die das nicht begreifen. Ihre Angst vor neuen Schulden führt uns ins gesundheitspolitische Verderben. Viele der 1117 Toten der letzten zwei Wochen hat man in Kauf genommen, weile man keine gesundheits- und wirtschaftspolitischen Massnahmen ergreifen wollte. Die Mehrheit im Nationalrat hat letzte Woche den dringend notwendigen Teilmieterlass für Gastronomie und Gewerbe abgeschossen. Bei den Härtefällen hat man geknausert. Menschen mit kleinem Einkommen erhalten bei der Kurzarbeitsentschädigung immer noch nur 80% ihres ohnehin zu tiefen Lohns. Und Ueli Maurer wird nicht müde zu behaupten, noch einmal so viel Staatshilfe könnten wir uns «nicht leisten». Die Schulden müssten wir «möglichst schnell wieder zurückzahlen». Als ob die Bundesbuchhaltung wichtiger wäre als die Gesundheit der Bevölkerung und die Sicherung von Existenzen. Ueli Maurer irrt aber auch finanzpolitisch. Wir können uns viele weitere Milliarden leisten. Problemlos.
Bund, Kantone und Gemeinden hatten 2019 Schulden in Höhe von 26% der Wirtschaftsleistung. Das ist im internationalen Vergleich lächerlich tief. Der Durchschnitt in Europa liegt bei über 80%. Alles unter 60% gilt als sehr tief. Neue Schulden kosten uns im Moment nichts. Dank negativer Zinsen wird der Staat sogar bezahlt fürs Schuldenaufnehmen! Ein Land mit einer leistungsfähigen Wirtschaft muss diese neuen Schulden faktisch gar nie zurückzahlen. Er wächst aus ihnen heraus, sobald die Krise vorbei ist und die Wirtschaft wieder brummt.
Wegen der Pandemie gehen Unternehmen zugrunde und Arbeitsplätze verloren. Ein Staat mit Zugang zu gratis Kapital wie die Schweiz darf das nicht hinnehmen. Statt so zu tun, als ob die gesundheitlichen Massnahmen Schuld an der Misere hätten, müssen wir endlich handeln. Mit einem viel besseren Gesundheitsschutz, der die Infektionen merklich reduziert. Und mit mehr und grosszügigeren Hilfen für alle betroffenen Menschen und Branchen. Wir schützen unsere Wirtschaft nicht, indem wir die Gesundheit opfern. Wir schützen sie durch grosszügigere finanzielle Hilfe. Dafür müssen wir nur etwas mehr Gratis-Schulden aufnehmen. Warum tun wir es nicht?
Dieser Text ist am 9. Dezember 2020 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Die Schweizerische Nationalbank, Stiftungen oder Einrichtungen der staatlichen und beruflichen Vorsorge sollen keine Investitionen in Kriegsmaterialproduzenten tätigen. Oder anders formuliert: Unser Volksvermögen soll nicht die Kriege und das Elend dieser Welt finanzieren. Das will die Kriegsgeschäfte-Initiative, über die wir am 29. November abstimmen.
Für die neutrale Schweiz ist es unwürdig, dass unsere Nationalbank und unsere Vorsorgeeinrichtungen heute Milliarden in Rüstungskonzerne stecken. Ethisch sind solche Geschäfte nicht vertretbar. Und wirtschaftlich sind sie gar nicht nötig. Das beweist zum Beispiel der äusserst erfolgreiche norwegische Staatsfonds, der sein Anlagevolumen von über 800 Milliarden Euro nicht in geächtetes Kriegsmaterial investiert.
Warum sollen unsere Nationalbank, die AHV oder schweizerische Pensionskassen nicht genauso erfolgreich wirtschaften können wie der weltgrösste Staatsfonds? Und warum sollten wir tiefere ethische Standards erfüllen als Norwegen?Beitrag zur friedlichen Welt
Die Argumente der Gegner sind letztlich Nebelpetarden. Mit Angriffen auf die KMU oder auf unser Rentensystem hat die Initiative nichts zu tun. Es geht am 29. November um eine Grundsatzfrage. Wollen wir unsere humanitäre Tradition wiederbeleben und einen Beitrag zu einer friedlichen Welt leisten? Oder nehmen wir weiterhin in Kauf, dass unethische Geschäfte mit unserem Volksvermögen die Glaubwürdigkeit unserer Neutralität untergraben?
Für mich ist die Antwort klar. Die Schweiz kann es besser. Wir können finanziell erfolgreich sein, ohne unser Geld in Kriegsgeschäfte zu stecken.
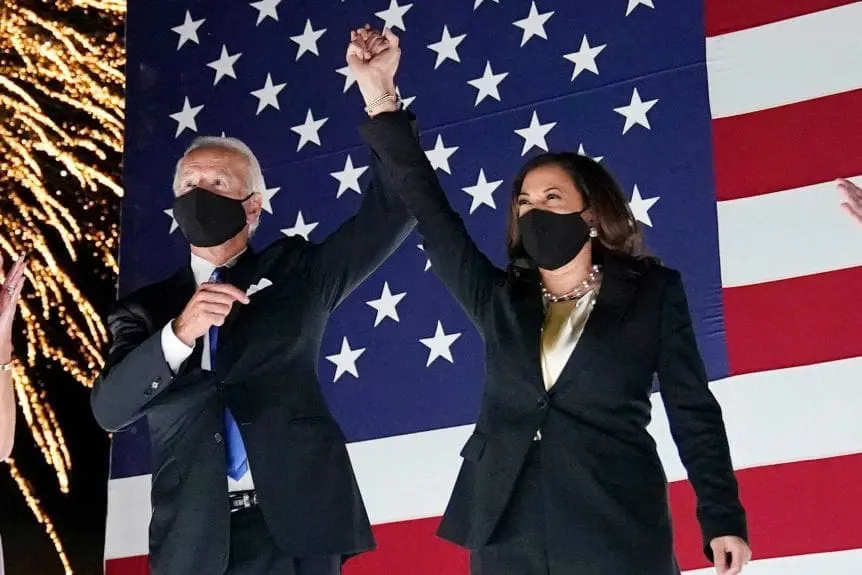
Seit Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist, steckt das Land in einer politischen Dauerkrise. Trumps Lügen, seine Korruption, der Sexismus und der Rassismus sowie seine Angriffe auf Rechtsstaat und Demokratie stehen für den Niedergang Amerikas. Trump hat die ohnehin schon polarisierte Gesellschaft definitiv zerrüttet. Das Ausmass der sozialen Ungleichheit ist dramatisch und brutale Diskriminierungen von Schwarzen, Latinos und anderen Minderheiten prägen den Alltag. Konstruktive Auseinandersetzung zwischen Konservativen und Progressiven sind praktisch unmöglich. Wut und Hass dominieren den öffentlichen Diskurs. Die Welt erlebt den amerikanischen Albtraum.
Diesseits des Atlantiks waren wir von Anfang an besorgt. Aber allmählich machte sich Abstumpfung breit. Das ist brandgefährlich. Denn Trump und seine Fans konstruieren «alternative Fakten» und schaffen so ideologische Parallelwelten, in die auch europäische Nationalisten gerne hinabsteigen. Für die Salvinis, Le Pens, Straches, Höckes und Köppels ist Trump ein Vorbild. Denn er hat vorgemacht, wie man als demokratisch gewählter Amtsträger die Macht dazu missbrauchen kann, demokratische Institutionen auszuhöhlen.
Irreparabel sind wohl die Schäden, die Trump seiner eigenen Partei zugefügt hat. Die ehemalige «Grand Old Party» hat bei diesen Kongresswahlen offiziell den politischen Inhalt abgeschafft. Zum ersten Mal seit 1856 (!) haben die Republikaner darauf verzichtet, ein Wahlprogramm zu verabschieden. Stattdessen wurde vom Parteitag ein einziger Satz beschlossen: «Die Republikanische Partei hat bis anhin und wird auch künftig die America-First-Agenda des Präsidenten mit Begeisterung unterstützen.» Konkrete Politik wurde durch nationalistischen Führerkult ersetzt.
Barack Obama hat nicht übertrieben, als er im August sagte, bei dieser Wahl gehe es um das Überleben der amerikanischen Demokratie. Den Beweis dafür hat Trump in den Tagen nach der Wahl erbracht. Indem er sich zum Sieger erklärte, bevor die Stimmen ausgezählt waren. Oder indem er mit haltlosen Betrugsvorwürfen die Wahlen delegitimiert und so sein Land ins Chaos zu stürzen versucht. Dieser Präsident greift mutwillig und frontal den Kern der Demokratie an.
Trumps Umgang mit der Pandemie hat zudem gezeigt, wie inkompetent und zugleich zynisch er ist. Statt seine Bevölkerung zu schützen, hat Trump das Virus verharmlost, sich über gesundheitliche Massnahmen lustig gemacht, Grossveranstaltungen ohne Schutzkonzept durchgeführt und am letzten Tag vor den Wahlen auch noch damit gedroht, den renommierten Gesundheitsexperten Anthony Fauci zu entlassen. Bald werden 250’000 Amerikanerinnen und Amerikaner an Covid19 gestorben sein. Hätte die Trump-Administration ebenso schnell und kompetent auf die Pandemie reagiert, wie zum Beispiel die deutsche Regierung, wären Stand heute deutlich über 100’000 amerikanische Tote weniger zu beklagen. Doch statt gegen die Pandemie vorzugehen, versuchen Trumps Republikaner, die von Präsident Obama eingeführte Krankenversicherung über die Justiz abzuschaffen. Mehr Zynismus und Politikversagen kann man sich nicht vorstellen.
«Die Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen suche», hat James Joyce eine Hauptfigur seines Ulysses sagen lassen. Joe Biden und Kamala Harris werden am 20. Januar 2021 ins Weissen Haus einziehen und dort vor enormen Herausforderungen stehen. Sie werden sofort überzeugende Antworten auf die Pandemie, die Rezession, die Klimakrise und die Spaltung der Gesellschaft finden müssen. Ein Erfolg ist überhaupt nicht garantiert. Doch ab dem 20. Januar Tag dürfen wir wieder mit etwas Hoffnung nach Amerika blicken. An diesem Tag können wir endlich aus dem amerikanischen Albtraum erwachen.